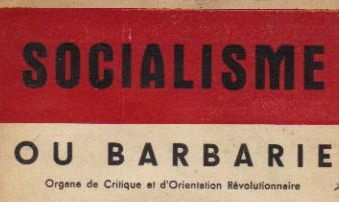Und die Arbeit ist überall, jederzeit. Wenn die Unterdrückung absolut ist, gibt es keine Muße, keine “Freizeit” mehr. Der Schlaf wird überwacht. Der Sinn der Arbeit ist dann die Zerstörung der Arbeit bei der und durch die Arbeit. Wenn aber, wie es in manchen Konzentrationslagern vorkam, Arbeiten darin besteht, im Laufschritt Steine zu einem Ort zu schleppen, sie aufzutürmen, um sie dann, immer noch rennend, wieder zum Ausgangspunkt zu bringen … Dann kann die Arbeit nicht mehr durch irgendeine Sabotage zerstört werden, wenn sie bereits dazu bestimmt ist, sich selbst zu vernichten. Trotzdem behält sie ihren Sinn; nicht nur den Arbeitenden zu zerstören, sondern, unmittelbar, ihn zu beschäftigen, ihn zu fixieren, ihn zu kontrollieren und ihm gleichzeitig das Bewußtsein zu geben, daß Produzieren und Nicht-Produzieren ein und dasselbe sind, ebenfalls Arbeit ist … Maurice Blanchot zum Arbeitslager
Ist die heutige Situation nicht ganz ähnlich? In einem aktuellen Interview in der Zeit spricht Giorgio Agamben von der “Geschäftslosigkeit” als einem Korrektiv zur ubiquitären Produktionslogik des Kapitals. Diese These wird aber erst dann verständlich, wenn das Dispositiv der (Lohn)-Arbeit grundlegend angegriffen und destruiert wird.
Die erste These ist hier die, dass es bei Marx keinen allgemeinen, konsistenten Begriff der Arbeit gibt und diesen auch gar nicht geben kann. Das Lavieren von Marx selbst, wenn er von toter und lebendiger Arbeit spricht, von produktiver und unproduktiver Arbeit, von konkreter und abstrakter Arbeit oder gar von Arbeit sans phrase, all dies zeigt, dass der Begriff der Arbeit bei Marx letztendlich fehlt. (Man könnte dem noch die hochaktuelle Unterscheidung zwischen sinnlicher und unsinnlicher Arbeit hinzufügen, wobei Letztere oft zu Unrecht als immaterielle Arbeit bezeichnet wird.) Eine der ersten Interventionen von Marx gegenüber der klassischen Nationalökonomie bestand darin, deren transhistorische Bestimmung von Arbeit als grundlegende Quelle und Maß aller Werte anzugreifen. Wenn die Arbeit wirklich Quelle allen Werts wäre, worin müsste dann der Wert dieser Quelle bestehen? Wahrscheinlich müsste dieser universelle Wert die gesamte Ökonomie der Äquivalenz in die Wirbel seiner heroischen Unermesslichkeit und Unabschätzbarkeit hineinziehen, aus deren Unsicherheiten herauszufinden dann nur noch, wie Marx dies teilweise auch vorgeführt hat, die Verflüssigung der Arbeit zur abstrakten Arbeitszeit hülfe, als deren äußeres Maß das Geld gleich einer ideellen Werteinheit den quantitativen Vergleich von Verschiedenem vollzöge. Marx könnte also aus dem Dilemma um den Wert der Arbeit herausgefunden haben, wenn er im vielbeschworenen »tertium comparationis«, als das ihm die abstrakte Arbeitszeit (und das Geld) gilt, ein objektives Maß gefunden hätte, auf dem der Vergleich von kapitalistisch produzierten Waren basiert. Aber so lässt sich der infinite Regress nicht abwenden, denn weder vermag man die Einheit einer einfachen (gegenüber einer komplizierten) Arbeit so ohne Weiteres bestimmen (niedrige versus höhere Reproduktionskosten), noch kann das immanente Maß abstrakte Arbeit ohne Weiteres mit dem äußeren Maß Geld verkoppelt werden.
Marx ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass die lebendige Arbeit zwar Wert schafft, aber selbst keinen Wert hat. Und wie so oft schlägt Marx eine weitere (verschobene) Lösung vor, die in der Stellung eines neuen Problems besteht, das heißt in der Strategie der Erfindung und Umgruppierung von Begriffen und ihren dazugehörigen Konstellationen. Nicht die Arbeit, sondern die Arbeitskraft besäße Wert, sie werde gekauft und verkauft, schreibt Marx, und diese Aussage ist mehr als nur eine Lappalie, die sich da mit dem Begriff der Arbeitskraft andeutet und sich in der Bestimmung der Differenz von Arbeit und Arbeitskraft fortschreibt. Inmitten der Arbeit selbst wird die Schrift einer Differenz entdeckt, um jede Substanz oder jedes Wesen, das man gemeinhin der Arbeit andichtet, von vornherein in Verruf zu bringen. Es zu konstatieren, dass die Produktion der Arbeitskraft selbst Arbeit verlangt, muss die Arbeitskraft doch physisch erhalten werden, durch Ausbildung, Qualifikation etc., um als Wert besitzendes Vermögen (und eben nicht als Arbeit) in die Zirkulation einzutreten; es wird laut Marx die Arbeitskraft zu ihrem Wert gekauft und deren Gebrauch im Arbeitsprozess resultiert in einem von ihr geschaffenen Wert, der größer ist als sie selbst als Tauschwert darstellt. Indem Marx damit eines der grundlegenden Theoreme der klassischen Nationalökonomie aushebelt, verstellt er gleichzeitig den Weg, eine weitere Teleologie der Arbeit zu konzipieren. In der Differenz von Arbeit und Arbeitskraft zeigt sich an, dass die Arbeit keine ökonomische Kategorie ist. Entscheidend bleibt, dass der Arbeiter Wert erzeugend nur sein kann, wenn das Kapital die an sich unproduktive Arbeit produktiv in Kraft setzt, und dies geschieht über die Vermietung der Arbeitskraft, die ein produktives Vermögen darstellt, dessen Gebrauchwert nur für das Kapital da ist. Nur in der Relation zum Kapital ist die Arbeit werterzeugend, ansonsten ist sie ein wertloses Nichts, noch nicht einmal Beschäftigung, auf die die Arbeit heute reduziert ist.
An dieses Theorem knüpfen auch Deleuze/Guattari in den “Tausend Plateaus” an, wenn sie konstatieren, dass Mehrarbeit nicht das sei, was über die Arbeit hinausgehe, sondern umgekehrt Arbeit aus der Mehrarbeit folge und diese voraussetze. Arbeit und Mehrarbeit seien schlichtweg dasselbe,”wobei erstere für den quantitativen Vergleich von Aktivitäten steht und letztere für die monopolitische Aneignung der Arbeiten durch den Unternehmer (nicht durch den Eigentümer).” Diese an Marx anknüpfende Erkenntnis wurde nicht nur vom traditionellen Arbeitswertmarxismus, sondern auch von der neuen Wertkritik (von Kurz bis Heinrich) weitgehend verschüttet, bei letzterer mit der bis heute fruchtlosen Diskussion über den Begriff der abstrakten Arbeit, der einmal als Substanz (Kurz), ein anderes Mal bewusstseinstheoretisch (Heinrich) erfasst wird.
Eine als Wesen oder als transhistorisches Prinzip verstandene Arbeit, wie dies sozialdemokratische und marxistisch-leninistische Orthodoxien in der Geschichte der Arbeiterbewegung bis zum Erbrechen vorgeführt haben, passt sich exakt in das hylemorphistische Schema ein, das die (ontologische) Differenz von Materie und Form anstrengt, um im Zeichen der Arbeit, die sich hier als die Formung der Materie ausweist, einen universellen Sinn in die Geschichte der Menschheit einzuschreiben. Der traditionelle Arbeitsbegriff, der seinen diskursiven und verfahrenstechnischen Ort in der handwerklichen Welt besitzt und in der Folge auch die Maschinen nur als Mittel denken kann, muss die prinzipielle Medialität und Technizität der Operation Arbeit verleugnen. Die Arbeit unterliegt Formbestimmungen, ist aber selbst nicht als Inhalt zu verstehen, der sich ausdrückt; die Arbeit ist auch nicht Stoff, auf dem der allgemeine Reichtum basiert oder eine finalitäts- und ergebnisfxierte Aktion, die qua Formung der Materie eine Gestalt annimmt, und dies schon deshalb nicht, weil die Formbestimmungen medial zu erfassen sind Ihren Relationen setzt sich Arbeit quasi von außen zu, um sich durch die Formen hindurch an den Produkten festzumachen, und letztendlich gerinnt die Arbeit sans phrase zur Spur einer maschinellen Bewegung, die die Arbeit und die Produktivität überhaupt erst hervorbringt und die Dualität von Inhalt und Form gar nicht kennt. Der Entzug der Arbeit besteht darin, dass sie weder dem Käufer der Arbeitskraft noch der Awendung durch die Maschinerie wirklich gehört, und wenn, dann wird sie von der formellen, maschinellen Bewegung zeitlich, das heißt befristet angewandt. Überhaupt lässt sich über Arbeit sans phrase nichts aussagen, sprachlos geworden taumelt sie im Riss des Symbolischen umher, sans phrase bleibt sie eben nicht symbolisierbar oder ausdrückbar, sie bleibt nicht bestimmbar und lässt sich an keine Logik des Begehrens oder eine Metaphysik des Ausdrucks anbinden, vielmehr perpetuiert sich in und mit ihr eine Differenz (zwischen Arbeitskraft/Arbeit), während das Geld der Differenz aufsitzt, deren Spur sich damit schwerlich verorten lässt, weil das Geld Reales, Imaginäres und Symbolisches durchquert. Indem das Symbol im Geld ausdrücklich wird, begegnet es nicht nur allen anderen ökonomischen Ausdrücken, sondern steht auch sich selbst als und im Ausdruck gegenüber. Als Selbstzweck gesetzt muss das Geld als Kapital zu seiner Verwertung führen, weil es ansonsten in der Tautologie des Geldes als Geld zu verdampfen droht. Es kommt also darauf an, dass die tautologische Identität des Geldes als Geld eine Potenz enthält, sich in die Produktion auszulegen, in der eine Differenz zu entdecken ist, die dafür verantwortlich zeichnet, dass das Geld durch die Realisierung der Resultate der Produktion eine rein quantitativ zu bestimmende Vermehrung des Geldes aufzeichnet. Ausgelegt wird das Geld in den Produktionsprozess in zweifacher Bedeutung, vorgestreckt als Kredit und auseinandergelegt als Produktionsprozess, um anschließend mit einem Mehr zu sich zurückzukommen. Die quantitative Vermehrung impliziert ein produktive Kraft, die das Geld realisiert und damit hält es auch eine Differenz zu sich selbst fest, die rein quantitativ ausfällt. Damit diese Realisierung anzeigen kann, dass die Auslegung des Geldes zu seiner Vermehrung geführt hat, wobei das Geld zwar für die Vermehrung maßgeblich ist, aber sie selbst nicht leisten kann – sieht man zunächst vom fiktiven Kapital ab -, muss Marx an diesem Punkt die Differenz zwischen Arbeit und Arbeitskraft erfinden, und hierin erweist sich die Differenz der Arbeitskraft als Tauschwert und Gebrauchswert maßgebend (und mit ihr wird die Arbeit erfunden). Das Geldsymbol lässt sich also auf der Arbeit sans phrase nieder und zugleich wird im Selbstbezug des Geldes, G-G`, eine bisher verschwiegene Differenz zu entdecken sein, die Differenz zwischen dem Tauschwert, den die Arbeitskraft herstellt, und dem Tauschwert, den die Arbeitskraft darstellt – und diese Differenz verdankt sich wiederum dem Gebrauchswert der Arbeitskraft, der je schon in die Zeit fällt, denn das Arbeitsvermögen, das darin besteht, Waren mit größerem Wert zu produzieren als die Arbeitskraft selbst wert ist, kann nicht gleichzeitig Äquivalenz und Nicht-Äquivalenz herstellen, es kann dies nur in der Zeit tun.
Heutzutage werden in einem doppelzüngigen Mechanismus Einkommen, Löhne und Ersparnisse in großen Dimensionen in die Maschinen der Finanzialisierung eingesaugt, indem man die Lohnabhängigen mithilfe solcher Faktoren wie Betriebsrenten, Versicherungen und Pensionsfonds selbst in kleine Finanzinvestoren transformiert. Schon in den neoliberalistischen Theorien der Chicago-Schule erscheinen die Lohnabhängigen nicht länger als abhängig Beschäftigte eines Unternehmens, sondern transformieren sich andauernd selbst zu »Human Capital« (körperlich-genetische Manifestation, Gesamtheit der erlernten Fähigkeiten bzw. Resultate der eigenen »Investitionen« qua Ernährung, Erziehung und Ausbildung) bzw. zu Unternehmern, die ganz eigenverantwortlich ihre jeweiligen Investitionsentscheidungen treffen, um ihren subjektiven Nutzen zu optimieren, der sich in Geld ausdrückt. Man transformiert in den Regimen des Neoliberalismus vor allem auch die Angehörigen des sog. Prekariats zu Unternehmen ihrer selbst. Und es ist kaum verwunderlich, dass diese Art der Verallgemeinerung der Unternehmensform heute zu einem sozialen Modell gerinnt, innerhalb dessen die Akteure aber seltsamerweise weniger als Produzenten von Waren und Dienstleistungen fungieren, sondern als Konsumenten von Arbeit (die auf dem Arbeitsmarkt als verkörperte Nachfrage nach Arbeit gelten und eben nicht als verkörpertes Angebot) am Tropf des Arbeitsmarktes hängen, wo sie zu Kunden von Agenturen mutieren, zu Käufern von Arbeit, wobei eine Verschiebung stattfindet, insofern die Arbeitskraft nicht in erster Linie in der Produktion verbraucht wird, sondern sich insbesondere über einen Kaufakt zeitlich befristet aktualisiert.
Oliver Marchart spricht an dieser Stelle von einer transversalen Prekarisierung, die im neoliberalen Akkumulationsregime fast alle Lohnabhängigen von der Toilettenfrau bis hin zum Start-up-Unternehmer beträfe und sich noch bis in die vertragsbasierten Sektoren der Normalarbeit auswirke. Aufgrund der transversalen Effekte lässt sich das Phänomen der Prekarisierung nicht mehr auf bestimmte soziale Strata oder generell instabile Arbeitsverhältnisse wie bspw. Zeit- oder Honorararbeit begrenzen, vielmehr durchquert es als ein Prozess der Verunsicherung und des Lohnabbaus tendenziell sämtliche Schichten und Bereiche im Gesellschaftskörper. Wenn sich, wie der Postoperaismus schon früh erkannt hat, die Arbeitsräume der Fabrik über das gesamte soziale Feld ausdehnen, während gleichzeitig die zur Produktion bestimmter Güter (Dienstleistungen, Wissen, Sprache, Affekte) erforderlichen intellektuellen Qualifikationen sich auf das gesamte gesellschaftliche Arbeitskräftepotenzial ausweiten, dann verschwimmen die Konturen des klassischen Arbeitsbegriffs inklusive seiner zeitlichen Verordnungen und Lokalisierungen endgültig. An den Arbeitsmärkten wächst gegenwärtig der Anteil der in Netzwerken strukturierten Projektarbeiten kontinuierlich, wobei diese mobilen und flexiblen Produktionsprozesse nicht nur die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit fließend machen, sondern permanent auch die Technologien der Selbstverwertung als eine Produktivitätsressource anzapfen, um schließlich das Begehren nach Selbstkontrolle und -bestätigung unternehmerisch denkender Subjekte immer weiter anzuheizen. In der Folge dringt die Syntax prekarisierter Arbeitsverhältnisse in Form einer kodierten Hypothese, die den Beteiligten Kreativität und Selbstverwirklichung verspricht, obsessiv in die neuronalen Netze und Psyche der Dividuen ein. Während der klassische Arbeitsvertrag noch den Anspruch auf die Erhaltung der Arbeitskraft beinhaltete, der auch bei Verlust des Arbeitsplatzes durch einen indirekten Lohn garantiert wurde, so entspricht heute die Prekarisierung der Arbeitskraft einer Ubiquität von Arbeit, die sich jedoch als ein existenzielles Risiko manifestiert, das heißt die Prekarisierung bindet die Einkommen mehr oder weniger direkt an die risikobehaftete Entwicklung der Zins- und Profitraten vor allem des finanziellen Kapitals, wobei ein Sinken der Raten sich als Druck auf sämtliche Produktionsprozesse auswirkt, sodass die Beschäftigten entweder mit höherer Intensität oder länger arbeiten, Lohnabzüge in Kauf nehmen müssen oder eben entlassen werden. Darin formuliert das Kapital seine sozialen Relationen aus: Risiko gestaltet sich nicht einfach als eine bloße Form der Kalkulation, als eine Art des Wissens um die Unsicherheit, sondern eröffnet einen ganz neuen Modus des sozialen Seins. Vielleicht mutiert gerade deswegen die therapeutisierte und zugleich therapeutische Arbeit der prekären Mittelschichten zu einer neuen Art des Extremsports. Dabei verschraubt man die diversen Technologien des Selbst mit der ökonomischen Logik der Prekarisierung und Letztere fordert dazu auf, noch alle Risiken und Kosten des Sozialen, die ja größtenteils schon privatisiert sind, auf sich zu nehmen, sodass eben private Schulden, niedriges und prekäres Einkommen (Arbeit auf Honorarbasis) oder wettbewerblich ausgerichtete Sozialleistungen rein individuell zu managen sind.
Die krankmachende Verarmungsmaschinerie, welche andauernd Billigarbeitskräfte und Sozialhilfeempfänger ausspuckt, ist der unhintergehbare Horizont dieser Art der Entfaltung des Beschäftigungssystems. Ihr wirklicher Ort ist das virtuelle Arbeitslager: 40qm Buden, in denen die Arbeitslosen an digitale Konsolen angeschlossen sind. Mit Konsequenzen: „Der immer noch geläufige Ausdruck stempeln gehen entstammt einer Zeit, als Arbeitslose täglich mit ihrer Stempelkarte beim Arbeitsamt erscheinen und sie abstempeln mussten. Vor diesem Behördengang drückte sich keiner, weil er mit der Auszahlung der Tagesration an Unterstützung verbunden war. Es versteht sich von selbst, dass es dabei zu Warteschlangen und Gedränge kam. Die heutige monatliche Überweisung aufs Konto ist bequemer, um den Preis freilich, dass ein Arbeitsloser mutterseelenallein mit Discounterbier vor der Glotze verschimmeln kann. Ohne Aufsehen zu erregen oder ein öffentliches Ärgernis zu werden löst sich dieser Fall mit der Zeit von selbst. Stehen hingegen hundert Einzelne wartend herum und fühlen sich von der schikanösen Prozedur provoziert, kann es zu Motzereien kommen, und die Motzereien können sich zu einem Tumult aufschaukeln. Es kann sogar passieren, dass die Einzelnen sich als Masse empfinden und so handeln, indem sie zum Beispiel das Mobiliar zerlegen und den Schalter stürmen.“ (Wolfgang Pohrt)
Sozialhilfeempfänger haben aber heute wirklich noch mehr zu tun, als nur durch den Besuch der »stalinistischen« Zwangsernährungs-, Bekleidungs- und Ein-Euro-Ketten ihr Leben phasisch zu sichern, vielmehr haben sie sich, mitunter auch durch Panik angetrieben (der Panik der Selbsterhaltung) in das Soziale zu integrieren, indem sie dem Staat eine Garantie zur Rückzahlung ihrer empfangenen Alimente geben, dies allerdings nicht in der Form von Geld, sondern durch die permanente Abgabe von Aktivitätsprotokollen, einer kontinuierlichen Anstrengung, die darin besteht, seinen Status als Schuldner ganz praktisch zu rechtfertigen, indem man selbst noch die vageste Einsatzbereitschaft zu jeder Art von Beschäftigung affirmiert und dann diese Beschäftigung auch ausführt – es geht hier um die permanente Exekution einer freien Disponibilität, eine Art Vollzeitaktivität, die ihren Sinn darin findet, alle Zwänge auszuhalten, so zum Beispiel die notorisch nervende Beratung durch Coaching, Schriftverkehr der Jobcenter und deren Fortbildungsmaßnahmen; Maßnahmen, die im besten Falle so etwas wie die Erfahrung der Sinnlosigkeit hervorbringen. In loser Anlehnung an eine tatsächlich schon stattgefundene Ausstattung von Hartz-IV-Beziehern mit Schrittzählern, die wahrscheinlich der Körperertüchtigung und der Reinigung der Psyche auf die Sprünge helfen sollen, könnte man nun Folgendes formulieren: Der Schrittzähler verwandelt die verdrahteten Akteure in gestreamte Fleischströme, deren Zahl, Verteilung, Gesundheitszustand etc. always in Echtzeit bekannt ist. Das industrielle In-Bewegung-Halten der virtuellen Fleischströme (bei so gering wie möglicher Lagerhaltung) transformiert die Akteure in Datenbanken und die Jobcenteraufseher in Kontrolleure technisch codierter sozialer Prozesse, die sie im Auftrag des Staates durchführen. An diese Logik ist das prekäre Subjekt potenziell angekoppelt – wie es sich heute tatsächlich auch darstellt, wenn es sich selbst hinsichtlich der Organisation von Minijobs als unternehmerisches Subjekt verhalten soll, bezüglich der Investition in die individuellen Versicherungen, der Organisation der Ausbildung, der Konsumentenkredite oder sonstiger Darlehen, sodass verschuldete Subjekte tendenziell mit ihren prekären Funktionen des Angestellten-Daseins, des Sozialhilfeempfangs und des Konsumenten von Dienst zusammenfallen, während die Finanzökonomie sich an dem Paradox abarbeitet, dass ausgerechnet diejenigen, deren Löhne und Honorare auf allen Ebenen beschnitten werden, die kaufkräftigsten Konsumenten sein sollten, was natürlich nur mit der Vergabe von Konsumentenkrediten zu »lösen« ist.
An die Stelle des Produzenten, der sich im Laufe der kapitalistischen Historie zumindest für gewisse Lebensphasen von seiner Internierung in der Fabrik sowie von der kompletten Rechtlosigkeit in Sachen Freiheit emanzipiert hatte, der also immerhin die Freiheit besaß, ohne wenn und aber seine Arbeitskraft an Märkten anzubieten, tritt heutzutage – mit dem permanent stattfindenden Vollzug oder Nichtvollzug von Dienst – zunehmend der Konsument von Arbeit. Während der potenzielle Produzent am Arbeitsmarkt als Arbeitskraft noch ein Angebot verkörperte, stellt der Konsument von Arbeit die verkörperte Nachfrage dar. (Die Arbeitskraft wird an den Arbeitsmärkten designt und gehandelt, sie wird gecoacht und gecastet, sie wird zum flexiblen Modus für das Businessmodell einer Arbeits-Design-Industrie, die sie dem Permanent-Casting und schließlich im öffentlichen Tele-Casting als Fernsehbild dem Kannibalismus eines interaktiv entscheidenden Publikums aussetzt, das seine Geschmackskriterien wiederum von einer (schein-)heiligen Jury kopiert hat, deren Mitglieder geschulte Spezialisten bzw. Participants jener berühmt berüchtigten akklamatorischen und redundanten Medienindustrie sind, die sich gut darauf versteht, Phantombilder am laufenden Band zu produzieren, indem sie Akteure in die Aufnahmeapparaturen hinein lockt, die sich von nun fast in jeder Situation so verhalten, als würden sie gerade vor einer Kamera stehen.) Und selbst wenn heute der Produzent, woran kein Zweifel besteht, seine Arbeitskraft noch verausgabt, ist sie an ihm tendenziell gestrichen, weil er sich nicht mehr allein über einen Produktions-, sondern überdies als Konsument von Arbeit über einen Kaufakt definiert. Und je weniger heutzutage Notwendigkeit von Arbeit noch zu vermitteln ist, desto stärker soll die Nachfrage nach Arbeit zum ubiquitären Modell gerinnen, wobei man die potenziellen Produzenten über die diversen Vermittlungsdienste der Jobcenter in die Rolle von Konsumenten von »Arbeit« versetzt, was einer Vernetzung und Kontrolle von Körper, Sprache, Affekt und Wissen im sozio-ökonomischen Feld entspricht – dies bedarf weder der phasischen Internierung zwecks Verschleiß und Dressur der Arbeitskraft, wie dies im industriellen Kapitalismus der Fabriken des 19. Jahrhunderts noch der Fall war, noch bedarf es einer Art Internalisierung von Arbeitsdisziplin, welche das Subjekt an sich selbst regelt, wie dies fast durch die ganze Moderne hindurch galt. Vielmehr haben wir es heute mit der Installation eines Dispositivs des Dienstes zu tun, das im Zuge der Informationalisierung des Geldes, des Unternehmens und des Körpers und seiner kognitiven Fähigkeiten in toto – Sprache, Affekt, Wissen etc. – die Extraktion eines Mehrwerts ermöglicht, dessen Niveau nun untrennbar mit dem Niveau der Kontrolle verkoppelt ist. Und dies gründet von der subjektiven Seite her auf Dienstleistenden, die im klassischen Sinne nichts mehr produzieren, sondern vielmehr Informationen bewirtschaften, um zugleich den Dienst als reine Information zu konsumieren – einen Dienst, der Kontrolle, Wartung und Steuerung durch Information bedeutet, der keiner Form der Vergegenständlichung durch Arbeit mehr bedarf, der die Interkonnektivität und das Feedback propagiert, während sich die beteiligten Netzwerke und die zuständigen Kontrollen bis in die Wohnungen und den Schlaf von Dividuen hineinfressen. Baudrillard schreibt schon früh, dass im Dienst die Leistung vom Leistenden nicht mehr trennbar sei, und dies sei in der puren Ableistung von Zeit im Zuge einer Anwesenheitspflicht dokumentiert, womit sich die Arbeit als Dienst »retotalisiere«. Darauf, dass der Kauf von »Arbeit« durch die ihm vorausgesetzte Nachfrage eintreten wird, kann sich die »Moderne Dienstleistung« nicht nur im Hinblick auf die dem Konsumenten subjektiv so sehr fehlende Arbeit, sondern auch im Hinblick auf dessen Beratungs-, Trainings- und Weiterbildungsbedarf am Arbeitsmarkt verlassen, da er auf diesen Wissenserwerb, welcher der Steigerung seines Informationswerts dient, angewiesen bleibt. Je weniger der Dienst noch Dienst an der Arbeit ist, desto mehr mutiert er zum biotechnisch erhöhten Dienst an der Information mittels Aufsaugen, Bearbeiten und Speichern derselben. Dabei wandert die Information über den Dienst in den Körper und seine kognitiven Vermögen hinein und wird mit der Dienst(leistung) tendenziell identisch. Die Nachfrage nach Arbeit, die objektiv fehlt, wird zur Nachfrage nach dem, was an ihre Stelle tritt, sie wird zur Nachfrage nach dem, was die Arbeit ersetzt: Information, Automation und Digitalisierung. Immer leistungsfähigere Software steht bereit, um die Informationsströme mit den Körpern, den Affekten und den Hirnen von Dividuen zu verschalten, wobei diese durch die in die Programme encodierten Steuerungs-, Regelungs- und Feedback-Prozesse regelrecht in Haft genommen werden, weil mit dem Feedback eine Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Aktion innerhalb der zirkulierenden Logik der Ströme eingebaut ist. Diese transitive Normierung aller Situationen, das heißt die Integration der Akteure in die Systeme, in der sie als Zielpunkte in Netzwerken fungieren, wird recht eigenartig durch den Konsum der Angebote der Enhancement-Industrien supplementiert, die es wiederum ermöglichen, sämtliche Kräfte der Selbststeigerung wie eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Der eigene Fitness- und Wellness-Status wirkt wie »systemisches Doping«, das allerdings von Placeboeffekten kaum noch zu unterscheiden ist. Im gleichen Maß, in dem der neue Konsument von Arbeit, tendenziell arbeitslos, sein Arbeitslos als Vollzug einer Dienstleistung affirmiert, er sich sein prekäres Angeeignet-Werden fortlaufend und friedfertig aneignet, scheint die dem klassischen Arbeitsvertrag immanente Erpressung aufgehoben, als gäbe es ein unendlich zu erforschendes kreatives Arbeitsvermögen außerhalb der kapitalistischen Wirklichkeit, als sei der Dienstleistende eine Reinkarnation der Vergöttlichung von Arbeit. Darin ist reflektiert, dass der Verlust der Arbeit für die Aktanten heute als Katastrophe aufscheint, die mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln abgewendet werden muss – wenn kein Mensch mehr an die Arbeit glaubt, dann wird der Glaube an ihre Notwendigkeit universell. Konnte Marx noch trocken konstatieren, dass der Arbeiter nicht für sich, sondern für das Kapital produziert, um damit wirklich jede Apotheose, welche die Arbeit zum Idol erhebt, auszuschließen, so wird mit der kreativen Selbstkonfiguration durch den Kauf von Arbeit, die von der beständigen Konsumtion von Enhancement-Programmen stilvoll begleitet wird, eine wirklich unheimliche Genussfreude an der (digitalisierten) Arbeit wiederentdeckt, deren Propagandisten beständig ausposaunen, es handele sich bei den in informierende Netzwerke integrierten Dividuen tatsächlich um die Verkörperung kreativer Mit-Teilungen anstatt um reine Befehlsempfänger, die natürlich sich unter Umständen im Team gegenseitig die Befehle geben.
Dabei brechen heute selbst die weniger fragilen Lebens- und Arbeitsentwürfe an der Allgegenwart der Einschnitte, mit denen das Leben wie der Dienst immer schneller in Intervalle geteilt und verstreut und damit Kontinuität durch eine Art unbegrenzten Aufschub ersetzt wird – wahrlich ein anhaltender Schwebezustand, der auch das Nie-zu-Ende-Kommen lebenslangen Lernens in den Institutionen der Bildung und Weiterbildung perpetuiert. Es kommt zu einer Fragmentarisierung der Arbeitszeit und der Lebenszeit, und beide Zeiten bleiben eingespannt in den Prozess einer rasenden, deterritorialisierenden Rekombination. Bezahlte Zeit kann als Extraktion von Mehrwert am Telefon und/oder für eine Woche, einen Tag oder eine Stunde abgerufen werden, womit der Dienst fraktal und rekombinant wie das finanzielle Kapital selbst gerät. Auch die Qualifikation bleibt in Permanenz in die ubiquitären Geld-, Daten- und Informationsströme integriert, von denen sich sowohl die Lohnabhängigen als auch die scheinselbständigen Prekären, als handele es sich da um auf- und abschwellende Wellen, aufnehmen und forttragen lassen. »Der Mensch der Disziplinierung«, schreibt Deleuze, »war ein diskontinuierlicher Prozess von Energie, während der Mensch der Kontrolle eher wellenhaft ist, in einem kontinuierlichen Strahl, in einer Umlaufbahn. Überall hat das Surfen schon die alten Sportarten abgelöst.« Und er schreibt weiter: »Die Individuen sind ›dividuell‹ geworden, und die Massen Stichproben, Daten, Märkte oder ›Banken‹.« Dividuell hier im Sinne einer Teilbarkeit, einer informatorisch regulierten Aufteilung, u. a. mittels der Dispositive der Demoskopie und Datenerhebung, mittels Maschinerien, die nicht nur die weltbewegenden, alltäglichen Fragen stellen, sondern auch quasi-tautologisch noch die entsprechenden Antworten liefern oder vorgeben. Die Individuen geraten damit zu Zubehörteilen des finanziellen Systems und seiner Apparaturen, der Medienapparate und des Wohlfahrtsstaates und seinen kollektiven Institutionen (Internet, Schulen, Krankenhäuser, TV, Museen etc.) Und dass man ausgerechnet den Unternehmen eine Seele zuschreibt, das sei wirklich die größte Schreckens-Meldung der Welt, moniert Deleuze schließlich und bezeichnet in gleichem Atemzug das Marketing als ein Instrument der sozialen Kontrolle (im Rahmen der demoskopischen Sozialspionage sollte man ergänzen). Und es gilt hinzuzufügen, dass die Unternehmen – fraktalisierte Arbeitssysteme – ganz materiell Arbeitskörper als Dividuen eines gewollten Prädikats herstellen, welches Arbeitsdienst heißt. Mit anderen Worten, das Unternehmenssystem erfindet den Dienstleistenden als sein Prädikat.
Die Second-Hand-Lebensstile, deren chemische, modische und neurologische Modellierung sich auf der Basis von Regeln, Codes und ihren biopolitischen Steuerungen vollzieht, bedürfen zudem des Ankaufs von Fitness- und Wellness-Programmen der ubiquitären Lebensberater- und (mentalen) Kosmetikindustrie, die wie eine Dienstleistung in Anspruch genommen werden. Und dies vor allem, um mit der ständigen Potenzierung und Effektivierung des eigenen Leistungsniveaus und Profils »ganz« in jeglichen Arbeitsverhältnissen zu funktionieren, womit die Lebenszeit zwar nicht vollkommen in der Arbeitszeit aufgeht – wobei Letztere immer noch das geltende Maß ist, aber irgendwie nicht mehr als das richtige Maß erscheint, wie Virno schreibt, doch heute als selten konstitutiv für die Quantifizierung und Ausgestaltung der Arbeitszeit selbst zu gelten hat. Indem das Kapital sich der Lebenszeit von Dividuen zu bemächtigen versucht, bilden Arbeit und Leben potenziell eine, wenn auch zerrissene, Einheit, die durch den Konsum von Coachingprogrammen, Fortbildungsmaßnahmen und Castingevents, die allesamt der Integration ins »Arbeitsleben« dienen, garantiert wird. Und diese Art der Vollzeitaktivität müssen sich weite Teile der Bevölkerung durch eine Verschuldung auf Lebenszeit im doppelten Sinne des Wortes erkaufen. Allerdings ist diese schrecklich neue Zusammenfügung von Arbeit und Leben in der von Adorno gegeißelten Trennung der Lebenszeit in Arbeit und Freizeit längst schon angelegt gewesen, und zwar unter der eindeutigen Dominanz der kapitalistischen Verwertung (und ihrem Vernichtungspotenzial). Adorno schreibt: »Der starr prüfende, bannende und gebannte Blick, der allen Führern des Entsetzens eigen ist, hat sein Modell im abschätzenden des Managers, der den Stellenbewerber Platz nehmen heißt und sein Gesicht so beleuchtet, daß es ins Helle der Verwendbarkeit und ins Dunkle, Anrüchige des Unqualifizierten erbarmungslos zerfällt. Das Ende ist die medizinische Untersuchung nach der Alternative: Arbeitseinsatz oder Liquidation.«Diese Situation perpetuiert sich noch bis in die Gegenwart, wenn zeitgenössische Chefs sich betont locker geben, den Mitarbeitern das Du geradezu aufdrängen und notorisch behaupten, ihre Betriebe würde eine wunderbar flache Hierarchie und eine fast schon kosmologische Wellness-Atmosphäre durchziehen, während die Chefs im gleichen Atemzug ihre Mitarbeiter mobben, von den Informationsflüssen abschneiden oder wahlweise mit Arbeit überhäufen und sie durch die diversen Abteilungen jagen.
Wenn es schließlich dazu kommt, dass die Zeit der Arbeit und die Zeit der Nichtarbeit durch keine exakte Grenze mehr getrennt sind, dann besteht auch zwischen Beschäftigung und Nichtbeschäftigung kein wesentlicher Unterschied mehr. Deswegen kann Paolo Virno auch mit aller rhetorischen Überspitztheit schreiben: »Die Arbeitslosigkeit ist unbezahlte Arbeit; die Arbeit ist dann ihrerseits bezahlte Arbeitslosigkeit. Mit gutem Grund lässt sich also genauso gut behaupten, dass man nie zu arbeiten aufhört, wie man sagen kann, dass immer weniger gearbeitet wird.« Paolo Virno weist damit u. a. auf den Sachverhalt hin, dass der Kunde der »Modernen Dienstleistung am Arbeitsmarkt« längst schon dem von Günther Anders als »Automationsdiener« titulierten Subjekt oder dem von Baudrillard beschriebenen »Arbeitsmannequin« entspricht, das die nicht vorhandene Arbeit simuliert, als ob sie vorhanden wäre, oder dass sich durch die zu viel vorhandene Arbeit stimuliert, als ob diese gar nicht vorhanden wäre. Im gleichen Atemzug wäre auch die Freizeitbeschäftigung als eine Dienstleistung auszumachen, insofern sie ähnliche Mobilitäten und Mobilisierungen wie der Dienst erfordert, ähnliche Investitionen in das maschinelle »Human Capital«, das Dienst und Leistenden verschweißt; und somit wird das Arbeitsmannequin supplementiert, dieser kleinste gemeinsame Nenner, »der Pikkolo als Basis eines Irrealitätsprinzips der Arbeit.« Und Günther Anders schreibt: »Wahrhaftig, angst und bange kann einem werden, wenn man es sich klarmacht, daß auch jetzt, in diesem Moment, Hunderte von Millionen mit solcher Gymnastik beschäftigt sind, und daß diese Hunderte von Millionen sogar noch dankbar dafür sind, daß es ihnen, im Unterschied zu Millionen weniger Glücklichen: den Arbeitslosen, noch vergönnt ist, diese Gymnastik zu treiben; und daß sie verbissen das Recht auf diese Gymnastik als politisches Grundrecht proklamieren, in der Tat proklamieren müssen, weil sie ohne derart nichtige Gymnastik im Nichts stehen, oder – aber dieses ›Tun‹ ist nur eine Verbrämung von Nichtstun – vor dem Bildschirm sitzen würden; und weil sie gezwungen wären sich täglich durch den sich immer neu vor ihnen aufstauenden Zeitbrei durchzufressen.«Und ganz ähnlich schreiben Tiqqun: »Was MAN heute Arbeit nennt, bewertete MAN gestern als Freizeit – ›Videospiel-Tester‹ werden dafür bezahlt, den ganzen Tag lang zu spielen, ›Künstler‹ dafür, die Clowns der Öffentlichkeit zu sein; eine wachsende Masse von Unfähigen, die MAN Psychoanalytiker, Kartenleger, Coaches oder nur Psychologen nennt, werden fett dafür bezahlt sich das Lamento der anderen anzuhören …«
Diese Art von abgrundtiefer Trostlosigkeit (der Beschäftigung) bedarf seltsamerweise einer ganzen Reihe von Bedingungen hinsichtlich der Entlohnung und Kontrolle, sei es die individuelle Führung von Zeitkonten, die Protokollierung der Länge von Telefonaten, die penible Aufzeichnung von Meetings in den Unternehmen oder das ausführliche Studium von Compliance-, Sustainability- und Controll-Kompendien. Nicht dass man die Arbeit imitieren würde, wie es wohl der erste Blick nahelegen könnte, sondern etwas ganz anderes scheint hier der Fall zu sein: Man simuliert die Arbeit mittels der Erzeugung ihres Anscheins, und schließlich gerinnt heutzutage der soziale Sinn dieser Art von Semiosen zu derselben wie ihre Definition: Die flexibilisierte und mobile Ausführung eines Dienstes, der im Endeffekt die Simulation selbst ist (Implosion), und das in rigider Anbindung an die praktizierte Optimierung der Modi der Selbststeigerung durch den libidinös-nihilistischen Gebrauch von Beratungs-, Fitness-, Lifestyle- und Sinnstiftungs-Programmen (die unter Umständen auf Pump gekauft werden) sowie der ständigen Kontrolle dieser Operationen durch soziale und staatliche Institutionen und Organisationen im Rahmen einer gleitenden Anwesenheitspflicht. Im Arbeitsprozess wird heute vielfach rein abstrakte Zeit konsumiert, was eben die schlichte Anwesenheit auf einer Stelle unter Abwesenheit der Arbeit einschließt. Dieser spezifischen Form des postmodernen Dienstes korrespondiert die »Arbeit« im Gehäuse oder im System des maschinellen Feedbacks: der Druck auf einen Knopf als Funktion eines anderswo programmierten Ablaufs – damit ist die menschliche Arbeit tatsächlich nichts anderes mehr als das berühmte, von der Maschinerie erfundene und integrierte Residuum. Es gibt allerdings auch die ADHS erzeugenden Tätigkeiten, bei denen die Zeit, in der sich die Büroangestellten noch mit einer Aufgabe beschäftigen, periodisch, ja gar notorisch durch Kommunikation qua Telefon, Fax, E-Mail unterbrochen wird, wobei die Zeiten dieser Unterbrechungen länger als die der Aufgabenerledigung sind. Die Unterbrechung, die auf den Rhythmus der Informationsflüsse in den Kommunikationsnetzwerken zurückzuführen ist, suspendiert die Zeit der Aufgabenverarbeitung. Egal wie, die residuale menschliche Geste erscheint schließlich nur noch als eine fragmentarische Geste, als das sog. Anhängsel einer Subjektivierung, die von den Diagrammen der Maschinen gesteuert, integriert und wieder ausgeschieden wird. Die Organisation der Arbeit und die ihr komplementäre Subjektivierung ist heute vor allem das Feld einer diagrammtischen Pragmatik. Linguistische Imperative würden nicht dermaßen auf Prozesse der Subjektivierung einwirken können, wenn sie nicht durch asignifikante Semiotiken (Budgetplanung, Software, Rechnungswesen, Kontrollmanagemente etc.) gestützt würden – asignikante Semiotiken, die nicht sprechen, sondern funktionieren. Es scheint, als wäre die (technologische) Maschine selbst noch ins Herz des Wunsches eingedrungen, womit die residuale menschliche Geste inmitten der imaginären Totalität des Individuums – das heißt der Funktion des [i – a] bei Lacan – rein als der Fleck einer Markierung durch die Maschine aufscheint, und womit, so lässt sich folgerichtig mit Baudrillard schließen, Arbeit nur noch »bekundet wird, so wie man seine Untertänigkeit bekundet.« Je mehr die (objektive) Notwendigkeit der Arbeit sich nicht mehr darstellen lässt, desto mehr wird die Arbeit im Zuge ihrer universellen Präsenz heroisiert oder genossen, und dies geht so weit, dass sogar die Arbeitslosen und Kinder von der Arbeit besessen sind, insofern kein Zweifel aufkommt, dass man seine Arbeitskraft zur Sicherung des Lebensunterhaltes vermieten muss. Mit der Ubiquität einer Propaganda der Arbeit kommt es zur Kolonialisierung der Wochenenden, der späten Abende, ja sogar der Träume, bis die Bediensteten als sog. Human Capital nicht nur einen Job haben oder einen Job performen, sondern der Job selbst sind, wobei derlei Übereinstimmung von Job und Ego mit einem Genussakt zusammenfällt, was sich dem von Günther Anders als »Totalitarismus der Lust« bezeichneten Zustand annähert, der dann eintritt, wenn eben sämtliche Aktivitäten inklusive der »Arbeit« einen Anstrich von Genussakten erhalten.
Das die Arbeit bekundende Arbeitsmannequin gibt Kunde von einer weitgehend automatisierten Arbeit, und dies am effizientesten, wenn es heutzutage in der Finanzindustrie Eigentumstitel und Finanzderivate bewirtschaftet, wozu das Internet wiederum entscheidend beigetragen hat – so wird der Bildschirm als Interface zum ständigen Begleiter des Brokers, dessen Körper und Hirn selbst zum 24-Stunden-Monitor gerinnt, der Informationen, Marktgerüchte und Nachrichten in der Form pulsierender Datenpakete absorbiert oder wahlweise verbreitet, um hierin mit dem Hyperpuls der trotz des permanenten Einsatzes der Wahrscheinlichkeitskalküle weiterhin unvorhersehbaren Marktbewegungen verschaltet zu bleiben, bis schließlich der Broker selbst zu dem wird, was er in beschleunigt getakteter Permanenz bearbeitet und studiert: zu einem »pulsierenden und fibrillierenden Leuchtpunkt des Geldes«. (Kroker, Kroker, Cook 1999: 105) Und wirklich seltsam korrespondiert das Baudrillard’sche Arbeitsmannequin mit der sog. Industriesklavin eines Pierre Klossowski, der in ihr einen neuen Typus von Arbeitskraft sah, der u. a. Prostituierte, Models, Film- und Popstars umfasst, eine Spezies, die den Verkauf seiner heute häufig mittels plastischer Chirurgie hergestellten eigenen Reize zu einer neuen Lebens- und Daseinsform ausdifferenziert.3 Den bisherigen Endpunkt eines durch und durch medialisierten Arbeitsmannequins finden wir heute in der Leichtprominenz, die sich komplementär zu den Derivatgeschäften in der Finanzindustrie fortschreibt, indem sie eine funktionale Beziehung zwischen Derivat und der ubiquitären Ware Promi herstellt — so wird der Aufmerksamkeitswert bspw. eines Profifußballspielers durch den Preis einer Vielzahl derivativer Produkte kontinuierlich symbolisch aufgeladen. Der Markterfolg der von ihm beworbenen Waren wird seinen eigenen Preis steigern, während Waren, weil sie seinen Namen und damit ein Image tragen, selbst zu Derivaten mutieren, wobei beide Sorten von Derivaten füreinander da sind. Offensichtlich stützt der Profifußballer die von ihm beworbenen Waren, und umgekehrt: beide Sorten Derivat steigern ihren Preis in reiner Reziprozität, indem sie sich beiderseits in den medialen Gossen der Picture-Industry beglaubigen. Die Leichtprominenz zieht dann die letzte Konsequenz aus den Modi der Hyper-Kapitalisierung, wenn nämlich das Investment zur Erlangung von individuellem Wohlstand und Sicherheit an die Logiken der Dividenden und der steigenden Portfolio-Preise angeschlossen wird.
Da die neuen Managementmethoden mit ihrer wuchernden Semantik sowie Semiotik ständig das Wort »Performance« in den Mittelpunkt ihrer Strategien rücken, scheint für die Dienstleistenden der Unterschied zwischen Leistung und purer Angeberei, die durchaus auch eine Maßnahme zur Selbstmodifizierung sein kann, tendenziell aufgehoben. Gerade dies führt aber gerade zu dem allseits gefürchteten Karrierestress, der von der Angst lebt, dass der eigenen Leistung, die ja wie »Kapital« behandelt werden soll, nicht die supplementäre Performance entsprechen könnte (oder umgekehrt), so dass man sich letzten Endes gezwungen sieht, die eigene Leistung mit der Performance gleichzuschalten, was durchaus der von Baudrillard konstatierten Tendenz zur Simulation von Arbeit entspricht, nur dass hier die reine Anwesenheit in grauer Zeit durch die zu erstrebende Kombination von Leistung und Performance ersetzt wird, was wiederum heißt, dass zur leidigen Erledigung der Aufgaben noch die Darstellung der Aufgaben hinzutritt. Wahrlich eine seltsame Form der freien Kultivierung des Operierens mit sich selbst plus des Operieren-Lassens durch die anderen, wie dies Peter Sloterdijk in seinem Buch Du mußt dein Leben ändern als Forderung nach einer neuen vertikalen Virtuosität formuliert hat. Die Performance fordert Dividuen ein, die ständig zwischen radikalem Wettbewerb (der sich als eine selbst beschleunigende Aktivität des Immerselben und im Zuge dessen als ADHS-Produktion artikuliert) und Depression hin und her pendeln – wobei man im innerbetrieblichen Wettbewerb nicht nur kontinuierlich seine eigenen Ressourcen mobilisieren muss, um persönliche Vorteile zu maximieren, sondern es ist der Wettbewerb schließlich selbst, der auf eine kontinuierliche Nachfrage nach der Performance abzielt. Diese generalisierte Performativität, die mit dem Ideal einer Arbeit verschweißt ist, die unaufhörlich Selbsterfindung propagiert, kreiert das depressive oder das ADHS-behaftete Dividuum. Generell generiert die Beschleunigung des Informationsaustausches Pathologien, weil die Dividuen einfach nicht in der Lage sind, die immensen und ständig steigenden Mengen an Information, die in die Computer, Smartphones, Screens, elektronischen Tagebücher und Hirne eindringen, noch zu prozessieren.
Dass die neuen Konsumenten von Arbeit zusätzlich noch damit beschäftigt sind, sich die Readymades der neobuddhistisch inspirierten Coachingdiskurse und andere Soft Skills einzutrainieren, um so etwas wie eine Partial-Gemeinschaft der sozial Kompetenten und zugleich Eigentätigkeit und Eigenverantwortung einfordernden Aktanten gerade im Bürobetrieb herzustellen, wo jenseits der Gängelungen des überholten Fabriksystems die Parameter Lohnarbeit und Konkurrenz auch weiterhin das bestimmende Prinzip darstellen, das lässt einen wirklich aufhorchen, denn längst reicht ein höflich kooperativer Ton oder ein kurzes taktisches Gespräch, dem jede Tendenz zur Überkommunikation zuwider ist, nicht mehr aus, um die Zusammenarbeit im Büro unter Bedingungen, die man sich wahrlich nicht selbst ausgesucht hat, zu erleichtern, vielmehr wird ausgerechnet im Büro die Monadologie, die Max Horkheimer in seinen Notizen als aktives Prinzip sozialen Lebens im Kapitalismus diagnostiziert hatte, als bloße Illusion seltsam schräg dekonstruiert: Der Niedergang des öffentlichen Lebens als Resultat der kybernetischen Konsensfabrikation erscheint heute gerade im Bürobetrieb seltsam virulent zurückgenommen, ja das Ende der Öffentlichkeit findet im Büro sozusagen eine aktive Kompensation, und dies als die status-bezeugende kollektive Gestaltung eines Ressentiments, das andauernd die abstrakte Teilnahme am Gesellschaftlichen propagiert, und gleichzeitig als die status-erzeugende Bestialität eines durch und durch possessiven Individuums, das ständig sein Dividuum loszuwerden versucht. Es regieren im Medium des Operierens und Operieren-Lassens Widerstandslosigkeit, Flexibilität und Relaxing – ja, Wellness, Gesundheit und Fitness werden zum hart erarbeiteten Restposten, an den sich die Reminiszenz eines »anderen Lebens« allein noch halten kann.
Um also die monetär messbare Attraktivität der eigenen Person her- und sicherzustellen, installiert man an sich selbst die verschiedensten Regeln, Vorschriften und Dispositive des Lifestyle-Entertainments, für das die fein justierten Trainingseinheiten in den ubiquitären Psycho- und Fitnessstudios sowie die strenge Einhaltung jener minutiös genormten Fitness- und Wellnessprogramme auch sprechen. Denn das Surfen auf den Wellen des Dienstes verlangt nach Ausdauer und Geschmeidigkeit im Modus auto-operativer Wendigkeit, um überraschende Optionen im Job augenblicklich wahrzunehmen und unvermittelt neue Aufgaben auszuführen, es verlangt den Opportunismus als allgemeine Handlungsmaxime, durch die man sich stets gegenüber einer Vielzahl von Möglichkeiten offen hält, um die nächstbeste, die sich gerade anbietet, auch zu ergreifen, oder, um eine Option, ohne zu zögern, zugunsten einer besseren Gelegenheit fallenzulassen; so gebietet diese Art des Surfens die Ausformulierung eines zynischen Interesses, das dieselben Aussonderungen der Interessen Anderer als bedauernswerte, aber doch unvermeidliche Deformationen diffamiert. Und dieser Form des Dienstes korrespondiert eine volatile Subjektivität, die bis an die Grenzen der digitalen Mobilität ausgedehnt wird, um noch ihren Surplus einfahren zu können. Bernhard Stiegler kritisiert in diesem Kontext äußerst scharf eine heute vorherrschende Mentalität, die er mit »I-don’t-give-a-fuckism« umschreibt, eine generelle Attitude der organisierten Verantwortungslosigkeit – und dies geschieht komplementär zum Aufstieg der »stupidity, sillyness, crazyness« von Dividuen, die Stiegler als »the destruction of attention, an irresponsibility, an incivility, ›the degree zero of thought‹« beschreibt. Und je intensiver die Mitarbeiter eines Unternehmens sich aufgrund eines zeitweiligen, aber zugleich uneingeschränkten Einverständnisses den betrieblichen Regeln, Programmen und Dispositiven aussetzen und sich derer zugleich bedienen – inklusive der kybernetischen Feedback-Mechanismen, die kein dummer Gesinnungsstaat mit seinen Organen und Apparaturen der Überwachung und Kontrolle je erfinden könnte, weil eigentlich kein aktueller Bedarf nach ultraharter Ausforschung, Bespitzelung und Inhaftnahme von Agenten der Unzufriedenheit besteht (und diese Überwachung doch stattfindet) –, desto stärker schillert erst die Variationsbreite der individuellen Optionen im betrieblichen Feld auf. So bleiben heutzutage die Büroangestellten dem halbherzigen und doch pflichtbewussten Sich-Einbringen in den Büroalltag gerade aufgrund ihres quälenden Opportunismus, der noch den geringsten Vorteil auszunutzen versucht, jederzeit verpflichtet, ohne dass da unbedingt eine knallharte Arbeitsanweisung bestehen muss, und dies geschieht im Rahmen einer operativen Steuerung und Optimierung der eigenen Person, was wiederum im besten Falle die 100%ige Identifikation mit den Unternehmenszielen voraussetzt oder verlangt. Hierin übernimmt die doch eher raunende Gemeinschaft der Betriebsangehörigen das Geschäft einer therapeutischen, sekundären Kontrolle, welche die primäre, durch die kapitalistische Ökonomie inszenierte Kontrolle des Lohnarbeiters und des Prekären flankiert und vervollständigt.
Nicht länger unterliegen die Mitarbeiter in den Büros dem terrorisierenden Kommando einer Zentrale, stattdessen sind sie in flexible technologische Kontrollsysteme und horizontale Dispositive eingelassen, die sowohl ihre eigene Effektivität, ihren Status, ihre taktischen Bedingungen und operativen Aufgaben als auch die der anderen Mitarbeiter auf den Bildschirmen jederzeit abrufbar halten. »Online« zu sein kondensiert zur hegemonialen Arbeits- und Lebensform, ständig mobilisierbare Verfügbarkeit im Kontext einer flexiblen Normalisierung ist die Arbeit selbst, die sich die Bediensteten zusätzlich mit dem Konsum von Bildungs-, mentalen Wellness- und Fitnessprogrammen antrainieren, bis sie den Dienst im Zuge ihrer permanenter Rekursion mit den Maschinen quasi reibungslos inkorporieren.5 Mittels Mikrotechnologien, Laptops und Smartphones, die man meist sitzend bedient, werden die Mitarbeiter selbst einer modularen Logik folgend ständig in die Informationsströme eingebaut, die in den Netzwerken der Unternehmen zirkulieren. Unaufhörlich mobilisierbar und potenziell rund um die Uhr abrufbar bleiben die Angestellten mental angeregt, um aufgeregt in Real-Time auf die Fluktuationen der Informationsflüsse zu reagieren, die über ihre Bildschirme flimmern. Im Rahmen der technowissenschaftlichen und psychologistischen Dispositive, Programmierungen und Konstruktionsprinzipien gibt es heute kaum noch einen Arbeitsplatz, der nicht permanent auf Evaluierung gestellt und nicht auf das kreative Potenzial von Dividuen und Projektgruppen hinterfragt würde, um dann abermals evaluiert, das heißt auf neue Performance-Potenziale hin untersucht zu werden, aber dies eben weniger aufgrund des totalitären Drucks eines Leaders, sondern die Evaluation bleibt meistens eingebunden in das Team; und kein Team, das nicht nach Aussprachen, Ansprachen und Absprachen qua anglizierter Sprachspiele verlangt, von denen Wittgenstein nicht im Schlaf geträumt hätte. Das homogene Ethos aus Opportunismus, verantwortungsvoller Paarbeziehung und sozialem Engagement, das sich ganz heideggerianisch als Gerede oder systemdeutsch als Interaktion oder Kommunikation artikuliert, ein Ethos, über das jedes Bewerbungsschreiben heute hinlänglich Auskunft gibt, wird beständig neu verhandelt bzw. austariert, ohne dass der Coach, der in seiner Funktion als Unternehmensberater einem modernen Wanderprediger gleicht, es noch eigens zu empfehlen hätte. Im Rahmen der geforderten und bereitwillig vollzogenen und vor allem sehr operativ-gesprächigen Zwangsharmonisierung wird zugleich mit Hilfe eines politisierten Pseudo-Sadismus, das heißt insgeheim gegenseitiger Verachtung sowie dem paradoxen Interesse an operativer Passivität, ein Kampf aller gegen alle geführt, der die Intensivierung des Ressentiments sowie der Listigkeit, die ja im Gerede keinerlei Referenz mehr kennt, im Prozess des öffentlichen Absonderns von Meinung zur Folge hat. »Clever ist«, schreibt Wolfgang Pohrt, »wer es versteht, sie (die anderen) für sich einzunehmen oder sie hereinzulegen. Wer es nicht versteht, ist der Dumme.«