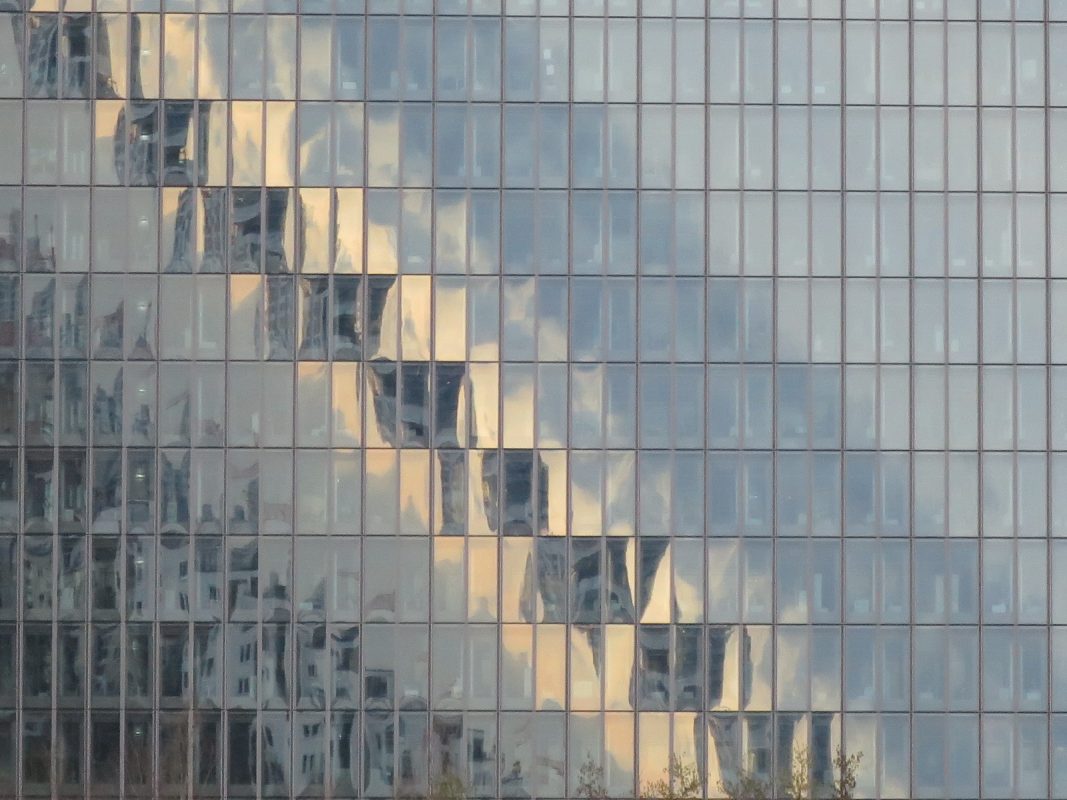„Geld regiert die Welt, und die von ihm regierte Welt droht in einer Katastrophe zu enden – sozial und ökologisch. Doch warum bestimmt das Geld überhaupt über den Lauf der Welt? … Mit dieser Herleitung des Geldes gelingt es endlich, auch das scheinbar ewige Rätsel zu lösen: was Geld überhaupt ist – und wie es zusammenhängt mit Wert und Kapital, Spekulation und Krise, Staat und Gesellschaft.“ So der vielversprechende Klappentext. Zudem wird das Buch als „revolutionär, noch über Marx hinaus“ gepriesen und „ein neues, tieferes Verständnis der Zwänge und der Allmacht des Geldes“ angekündigt.
Das erste Drittel des Buches widmet sich vormonetären Gesellschaften und deren sozialen Zusammenhängen, die bekanntlich in weitgehender Übereinstimmung als Verpflichtungsverhältnisse charakterisiert werden. Für all diese Gesellschaften bis zum Ende des Feudalismus waren Kauf und Verkauf lediglich randständige Phänomene, zumeist „lokal und zeitlich gebundene Veranstaltungen mit einem beschränkten Angebot an Waren.“ (109) Obwohl es dabei immer wieder auch zum Einsatz von Münzen und zur Gewährung von Krediten kommt, „fehlen wie der Begriff die Vorstellung von Geld, so auch der Begriff und die Vorstellung von Wert.“ Stattdessen fanden Tauschprozesse auf der Grundlage einer Schätzung statt. E.B. stellt somit „Wert“ und „Schätzung“ einander gegenüber. Das scheint angebracht, wenn man unter Wert eine in Geld ausgedrückte festgesetzte rechnerische Größe versteht, die einer Ware zugeordnet ist und das Verhältnis dieser Ware allen anderen Waren gegenüber ausdrücken soll (zum „Numéraire“ vgl. Harald Strauss 2013).
Im Wörterverzeichnis zum Codex Hammurabi z.B. gibt es tatsächlich kein Wort für Geld – im Text (z.B. §§ 50 + 51) wird Silber umstandslos mit Geld übersetzt! Auch bei Aristoteles: in der Münze (numisma) ist kein Geld zu sehen. E.B. hat hier ein exaktes Quellenstudium betrieben und es ist sein Verdienst, auf diese weit verbreiteten Fehlübersetzungen aufmerksam gemacht zu haben.
Da es keine Gewinn-Verlust-Rechnung gab, betrachtete jeder Tauschpartner angeblich die erhaltenen Güter als „Gewinn“. Wenn man versucht, unter Einbezug von Mauss, Hammurabi und Polanyi, diesen “Gewinn ohne Verlust” nachzuvollziehen, sich vom Wert-Gedanken völlig zu lösen und zu schauen, ob es wirklich ohne Wert gegangen sein kann, dann fällt auf, dass die entsprechenden Ausführungen dazu von Polanyi (stw 295:300ff.) komplexer sind, aber nicht ganz frei von der Geldkontamination. Kein Geld, kein Wert – so die These von E.B., aber (lt. Polanyi) immerhin Kredite und Zinsen, wenn auch nicht i.S.v. Geld, sondern als Dinge/ Realien, Beteiligungen, „Darlehen“, Schuldverhältnisse und Vorleistungen (Schiffsbau, Seeleute und deren Verpflegung usw.) – was bei der Verteilung der Rückfracht doch sicher zu berücksichtigen war… Das alles fehlt bei E.B. – und vor allem fehlt: wie der ganze „Tausch“ sich aus der Perspektive der Handelspartnerdarstellt haben mag… Hier wäre doch die Frage zu beantworten (gerade wenn nicht in/ mit Wert(einheit)en “gerechnet” wurde), wie entschieden worden sein könnte, z.B. wieviel Rückfracht es für die Hinfracht gab? Daß der Austausch im Außenhandel wie im Innenverhältnis (“nach Proportion”, 126ff.) geregelt worden sein könnte, ist unwahrscheinlich – selbst wenn es “nur diese Rückfracht” gewesen sein sollte, „die bei diesem Handel den Gewinn darstellt” (142). Schwer vorstellbar, dasses im Außenverhältnis keine angemessene Tauschrelation gegeben haben soll – fragt sich aber, wie es zum „Angemessenen“ kommt?
M.a.W.: Die vormodernen (Aus)Tausch-Relationen werden nicht dadurch plausibel, daß man ihnen jeglichen Wertbegriff nimmt – im Gegenteil: weil man es doch gewohnt ist, soziale Verhältnisse, und besonders, wenn es dabei um Verpflichtungsverhältnisse geht, als irgendwie wertgegründet und -geleitet zu denken und zu verstehen – wenn auch vielleicht nicht gemäß dem neuzeitlichen (ökonomischen) Wertbegriff. David Graeber hatte sich (in Die Falsche Münze unserer Träume) auf die Suche nach einem anderen Wertbegriff begeben… Was spricht dagegen, die vormodernen Tauschverhältnisse unter einen solchen anderen Wertbegriff zu subsumieren?
Im zweiten Teil behandelt E.B. die Entstehung des Geldes als Momentum historischer Verschiebungen: Bevölkerungszuwachs, Städtegründungen, Zunahme von Kauf und Verkauf. Wesentlich dabei ist: „Für eine ganze Gesellschaft wird es damit zur lebensbestimmenden Notwendigkeit, ein Tauschmittel fortgesetzt und kontinuierlich aus Verkäufen hervor- und in Käufe eingehen zu lassen. Das Tauschmittel innerhalb dieses spezifischen gesellschaftlichen Zusammenhangs, dieses in sich veränderte Tauschmittel – ist Geld. Die Geburtsstunde des Geldes ist daher zugleich die Geburtsstunde seiner Notwendigkeit. Es ist die Geburtsstunde der Abhängigkeit vom Geld. Ungewollt, und ohne sich dessen bewusst zu sein, geraten Menschen auf das Geld, indem sie in die Abhängigkeit davon geraten.“ (197)
Dabei ist der Unterschied wesentlich zwischen Dingen und Gütern, die gelegentlich und unter anderem auch als Tauschmittel dienen und demjenigen, „das ausschließlich als Tauschmittel fungiert“. Letzteres ist dann „nicht mehr Gut: Es ist stattdessen Geld.“ „Geld bleibt systemisch geschieden von den Waren, sofern sie Güter sind und eben nicht wiederum Geld.“ (198)
Der Unterschied zwischen Tauschmitteln und reinem Tauschmittel besteht darin: „Geld, das als das reine Tauschmittel nichts sonst ist als Tauschmittel, ist tatsächlich nichts sonst. Geld ist nicht etwas, es ist nichts.“ Daraus folgt: „Als das reine Tauschmittel muss Geld jeweils wieder in Güter getauscht werden, um weiterhin Geld und Tauschmittel zu sein.“ (199)
„Geld braucht immer und immer weiter Waren, um Geld und Wert zu bleiben … Geld erzwingt die Verwandlung der Welt in Waren. … Geld ist als solches unersättlich.“ (262) „Für jeden Geldeigentümer, für jedes Geldsubjekt gilt das Wertgesetz. Nur wenn ihm Waren mehr an Wert einbringen, als an Wert für sie aufzuwenden war, ergibt sich ein Geldgewinn und hat sich ihm Geld dadurch als Wert bewährt.“ (264) „Geldsubjekt … können die für sich wirtschaftenden Individuen sein, es können Unternehmen sein, Konzerne oder anderes.“ (265)
Bereits hier wird deutlich, dass E.B. nicht zwischen Geld und Kapital unterscheiden will und für ihn „der Zwang zu mehr … bereits für das Geld als solches besteht“. „Geld ist Kapital.“ (267) Leider findet sich im gesamten Buch kein Argument/ keine Begründung für die These, daß Geld dazu zwingt, sich (selbst?) zu vermehren… (der “objektiv“ im (!) Geld angelegte Zwang… 272) Folglich heißt es zum Wachstumszwang im Kapitalismus: „Und dieser Zwang, er ist der berühmte und zu Recht berüchtigte Wachstumszwang des Geldes.“ (268) Anstatt hier z.B. auf die Binswangers zu verweisen,wird der dem Kapital inhärente Wachstumszwang auf das Geld als solches übertragen. Diesen angeblich dem Geld selbst innewohnenden Wachstumszwang nennt er „Wertgesetz“ (256ff.), dem alle („Geldsubjekte“) unterliegen würden. Dabei wird nicht unterschieden zwischen Kapital und Arbeit; insbesondere wird hier das Privateigentum an Produktionsmitteln und dessen Folgen nicht thematisiert. Stattdessen wird argumentiert, dass aufgrund der Geldwirtschaft ein allgemeines Gegeneinander entsteht: „Die Verbindung, die das Geld über seine Form von Eigentum herstellt, ist ein Gegeneinander.“ (303) Herrschte im Feudalismus etwa ein Miteinander?
Wenn er seiner „Geldlogik“ gemäß Geld und Kapital gleichsetzt, unterscheidet er nicht zwischen hinreichender und notwendiger Bedingung: eine allgemeine Geldwirtschaft ist sicherlich notwendige Voraussetzung für kapitalistische Verhältnisse, aber noch keine hinreichende Bedingung: zur Entwicklung des Kapitalismus bedarf es zusätzlich zwingend der Voraussetzung von Geldkapital, d.h. letztlich des Privateigentums an Produktionsmitteln und entsprechend auf der Gegenseite des doppelt freien Lohnarbeiters. Geld allein jedenfallsmacht keinen Kapitalismus. Nicht zuletzt bezieht jener zudem ganz wesentlich auch zahlreiche unbezahlte Güter ein bzw. eignet sich diese jenseits direkter Ausbeutung von Arbeitskraft an (vgl. J.W. Moore).
So kommt die Frage auf, ob E.B.´s dualistisches Geldwertbild nicht doch etwas holzschnittartig ist. Nachdem er (durchaus berechtigt) beide Werttheorien (Nutzen und Arbeit) zurückgewiesen hat (234 ff.), ist sein Wertbegriff entleert – nur noch reines Quantum: der Wert ist (substanzialiter gesehen) ein Nichts. Damit gibt es nichts mehr, was die Wertgröße noch bestimmen könnte, denn die Ware hat keinen Wert (wenn es keinen Wert gibt). Damit verschiebt sich alles auf den Preis, der dann allerdings, anders als bei Marx, auch kein Wertausdruck (mehr) sein kann, weil es aus dieser Perspektive ja nichts (mehr) gibt, was ausgedrückt, „abgebildet“ oder repräsentiert werden könnte. Aber was bestimmt dann den Preis? Kommt man so nicht bei den Tautologien der Mainstream-Ökonomie aus, wo Preise mit Preisen “erklärt” werden?
Marx scheint diesen Umgang mit dem Wertbegriff geahnt zu haben: “Noch bequemer ist es natürlich, sich unter Wert gar nichts mehr zu denken. Man kann dann ohne Umstände alles unter diese Kategorie subsumieren.“ (MEW 23: 560) Und genau auf diese Art setzt E.B. zunächst Wert und Geld gleich, um anschließend alles unter die Kategorie des Geldes zu subsumieren.
Wenn es keinen Wert (mehr) gibt, kann es auch keinen Mehrwert (mehr) geben… Darum überspringt E.B. auch das Thema Produktion, Mehrarbeit und Mehrprodukt, um gleich zum „Mehr an Geld“ zu kommen (280/ 281) – fetischistische Reduktion auf G – G´ ? Jain: er zerlegt das, was Marx mit G – W – G´ meinte, in zwei voneinander getrennte Akte: G – W, wo man Arbeitskraft kauft und am Ende den Warenoutput hat, und dann, als neuen weiteren Akt der Verkauf dieses Outputs, W – G, mit Mehr-Geld am Ende (er schreibt „Geld + “ ; (285) – ohne zu erklären, woher dieses Mehr kommt. Er nennt das zwar „Mehrwert .. realisieren“ (285 unten), aber das ist bloß noch eine Reminiszenz… „Die Bezahlung, die zusätzliche Ware heckt“, ist alles mögliche: Arbeiter, Maschinen, Patent- oder andere Rechte, Grund und Boden, Tiere, Informationen usw. (286). E.B. sprichtnicht mehr von wert- oder mehrwertschaffender Arbeit, sondern nur noch von „wertschöpfender Ware“ (286 oben) und von„Mehrwert heckender Ware“ (282). Ist das ein Erkenntnisgewinn oder ein Fortschritt im Vergleich zu Marx? „Im zinstragenden Kapital erreicht das Kapitalverhältnis seine äußerlichste und fetischartigste Form. Wir haben hier G – G’, Geld, das mehr Geld erzeugt, sich selbst verwertender Wert, ohne den Prozeß, der die beiden Extreme vermittelt…. Im zinstragenden Kapital ist daher dieser automatische Fetisch rein herausgearbeitet, der sich selbst verwertende Wert, Geld heckendes Geld, und trägt es in dieser Form keine Narben seiner Entstehung mehr. Das gesellschaftliche Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dings, des Geldes, zu sich selbst. … Es wird ganz so Eigenschaft des Geldes, Wert zu schaffen, Zins abzuwerfen, wie die eines Birnbaums, Birnen zu tragen.“ (MEW 25, 404f.)
Nachdem beim Wertgesetz (256ff., insbes. Von Wert zu mehr Wert, 262f.) das Mehr-Motiv bzw. die Ursache für Mehr unklar geblieben war (dort gab es immer nur so prosaische Formulierungen wie „Geld erzwingt die Verwandlung der Welt in Waren“, „Geld als solches ist unersättlich“ (262), „Das Geld perpetuiert sich selbst, als diesen Zwang.“ (263) usw., als wäre es der Fetischcharakter G – G´ bzw. die Selbstvermehrung als solche), wird 321ff. endlich deutlich, was E.B. meint: Geld „muß sich von jetzt an“ und in alle Ewigkeit nach seiner Schöpfung „immer wieder als Geld bewähren – es muß zu Mehrwert führen und zu mehr Geld werden“ (321). „Es muß“ – zwanghaft. Bis jetzt hörte sich alles danach an, daß es sich selbst vermehren kann (resp. muß) – hat es sich aber in meinem Portemonnaie noch nie, in Ihrem? Man ahnt es – und erfährt es eine Seite später: Der Zins – Zins MUSS. Nein, muß nicht: die Zentralbank muß keinen Zins erheben, aber „sie kann auf die ausgegebene Summe Zins erheben“ (322). Tut sie momentan aber nicht. Wo hocken dann die Zwangsneurotiker, die auf Zins nicht verzichten können? Richtig, in den Privatbanken… Bei den Privatbanken, die Kredit aus dem Nichts per Keystroke schöpfen? Ja, denn derenKreditgeldschöpfung „muß“ sich rentieren, „da das Aufnehmen von Geld, falls sein Einsatz kein weiteres Geld einbrächte, nur Arbeit machen, Zeit kosten und sicher sonst noch irgendwelchen Verbrauch verursachen würde, also letztlich einen Verlust an Geld ergäbe“ (321). Oh, hat Geld doch mit Arbeit und Zeit zu tun? Das erstaunt nach 240ff. (Verwerfung der Arbeitswerttheorie). „Dafür muß das geschöpfte Geld weiteres Geld als Gewinn abwerfen“ (wie die Kuh ihr Kalb), „muß es – wie bekannt – eben mehr werden, um schließlich mehr zu sein als die Kreditsumme geschöpften Geldes, die auf die Rückzahlung und damit auf ihr Verschwinden verpflichtet ist. Dieser Zwang zu mehr, der von ihrer Geburtsstunde an auf jeder Geldsumme lastet, hat eine bedeutsame Folge, die heute oft – in der üblichen Verkehrung – als seine Ursache mißdeutet wird. Das Mehr muß sich ja, da der Zwang dazu besteht, in aller Regel ergeben, sonst käme das gesamte Geldsystem unverzüglich zu seinem Ende. Es muß der Normalfall sein, daß der Einsatz von Geld zu mehr Geld führt…“ (321f.) Eine bemerkenswert zirkuläre Erklärung, wo E.B. selbst Folge und Ursache „mißdeutet“: Geld muß mehr werden, weil es mehr werden muß. Aus Sicht der ZB stimmt es zwar nicht, wie er selbst zugegeben hat – und überhaupt: „Ein Zins auf einen Kredit ist nicht zwingend notwendig für das Funktionieren eines Kreditsystems.“ (Dirk Ehnts 2016:45) E.B. mag sich kein Kreditvergabesystem ohne Gelddealer, Höker und Zwischenhändler vorstellen – das will er unter allen Umständen verhindern, weswegen er auch die Vollgeldinitiative komplett ablehnt. Bliebe noch der Unternehmergewinn, der Profit. Solange Unternehmen in Privatbesitz sind und Aktionäre von leistungslosen Einkünften leben „müssen“, „müssen“ sie andere zu Mehrarbeit zwingen, wenn sie ein Mehr-Geld haben „müssen“. So einfach, so logisch. „Also hätten die Verfechter von ´Vollgeld´ zu erkennen: Geld, dessen Bestand nur zirkulär auf der Vermehrung seiner selbst beruht, kann niemals ´voll´ sein wovon auch immer, sondern ist darauf angewiesen, seine Funktion zu erfüllen – durch Erwirtschaftung von Mehrwert.“ (326) Genau dieses haben die Vollgeld-Verfechter ja erkannt – wenn auch nur z.T., da sie nichts gegen Gewinn und Profit haben, sondern die Zins-Arbitrage nur dem Staat überlassen möchten. Ihr Hauptanliegen (das unterschlägt E.B.) ist allerdings, die Buch- & Giralgeldkonten in ZB-Konten umzuwandeln, weil die Einlagen bei den Privatbanken bekanntlich nicht sicher sind.
Buchhalterisch besteht Geld nur aus Kredit und Schulden (Soll und Haben); eine Geldwirtschaft ist aber keine Wirtschaft, wo Geld sich (wie im Märchen) „rein“ durch Kaufen und Verkaufen vermehrt. Ein Geld, das nicht die Realwirtschaft durchquert, ist tatsächlich nur „ein bloßes Nichts“ (317). Ob Geld in der Realökonomie Zins und Profit machen „muß“ (wie der Zwangsneurotiker glaubt), und wovon das abhängt, was hier „muß“ oder nicht, soll oder kann – oder nicht sollte und auf keinen Fall darf…, das alles sind Fragen, die E.B. selbstherrlich und gezielt und um die „Allmacht des Geldes“ und den Kapitalismus zu zementieren vom Tisch fegt. Wenn eine Wirtschaft „ohne Geld“ seine ernsthafte Alternative wäre (wonach es nicht aussieht), dann hätte er sich dieser Frage auch ernsthaft stellen können und müssen – Gedanken dazu gibt es schließlich bereits.
„Man kann sagen, der an Zwang und Verboten Leidende benimmt sich so, als stehe er unter der Herrschaft eines Schuldbewußtseins, von dem er allerdings nichts weiß, eines unbewußten Schuldbewußtseins also, wie man es ausdrücken muß mit Hinwegsetzung über das Sträuben der hier zusammentreffenden Worte. Dies Schuldbewußtsein hat
seine Quelle in gewissen frühzeitigen Seelenvorgängen, findet aber eine beständige Auffrischung in der bei jedem rezenten Anlaß erneuerten Versuchung und läßt anderseits eine immer lauernde Erwartungsangst, Unheilserwartung, entstehen, die durch den Begriff der Bestrafung an die innere Wahrnehmung der Versuchung geknüpft ist.“
(Freud: Zwangshandlungen und Religionsübungen, G.W. VII, S. 135)
„Geld kauft Ware als Wert: Wert ist das Geld selbst und als Wert behandelt es die Ware. In der Form von Geld kauft Wert also Wert… Daher tritt Geld notwendig auch als Käufer von unmittelbar seinesgleichen auf. Geld kauft in diesem Fall direkt Geld… Der Kauf von Geld mit Geld, der also Geld mit Geld gleichsetzt, ist aber paradoxerweise nur dann nicht tautologisch und hat nur dann Sinn, wenn zwischen dem Geld hier und dem Geld dort gerade nicht Gleichheit besteht, sondern ein Unterschied. Und der kann kein anderer sein als der einzige Unterschied, zu dem dieses reine Quantum fähig ist, ein quantitativer: Wenn Geld Geld kauft, dann nur welches, das – spekulativ – mehr Geld verspricht.“ (332) Haben Sie hier (nicht im Ausland!) schon mal mit Geld Geld gekauft? Wenn einer mit 10 Euro 15 Euro kaufen wollte – ernsthaft jetzt, nicht zum Scherz: wer würde nicht an dessen Verstand zweifeln… Wer eine Ware im Wert von 10 Euro kauft – hat der nach dem Kauf „mehr Geld“? Natürlich nicht „mehr“, sondern weniger – und wer noch alle Tassen im Schrank hat, der weiß, daß G – W nicht gleich G – G´. Also auch hier scheint mal wieder was anderes gemeint zu sein – man ahnt es: der Kredit. „Der Kreditnehmer bezahlt ihn ja mit der Kreditsumme, die er zurückzahlen muß, plus Zins. Er kauft eine Summe Geld mit mehr Geld…“ Wer einen Kredit in Höhe von 1000 Euro von seiner Bank bekommt, bekommt genau 1000 Euro und keinen Cent „mehr Geld“; und wenn er dieses Geld ausgegeben hat, dann kann er es, also diese „Kreditsumme“ auch nicht zurückzahlen, weil sie längst woanders ist; er muß diese 1000 Euro „plus Zins“ zusätzlich zu dem verdienen, was er sonst so zum Leben braucht. Er kann also diesen Kredit überhaupt nicht „in der notwendigen Spekulation darauf, daß sie ihm selbst mehr einbringen wird“ (332), gekauft haben – diese Absicht kann einzig und allein der Kreditgeber/ die Bank gehabt haben. Auch hier beginnt man zu ahnen, daß wieder etwas anderes gemeint sein „muß“: Der kapitalistische Wertverwerter. Aber woher & wovon dabei der Zins kommt/ kommen soll, verschweigt E.B. Längst hat die Bank den Kredit und das Risiko verkauft – und schon kann das Dealen mit Verbriefungen, Derivaten und Derivaten von Derivaten beginnen… Und es ist (das wird im Kapitel Finanzwirtschaft 337ff. deutlich) diese Form des Geldes, die E.B. für dermaßen normal und regulär hält, daß er von ihr seinen Geldbegriff ableitet: „Dadurch, daß Geld selbstbezüglich wird, macht es sich in seiner Vermehrung unabhängig davon, ob es sich wirklich vermehrt. Das gehört zu seinem Wesen: Geld vermehrt sich wirklich, ohne sich wirklich zu vermehren.“ (333)
Achim Szepanski (Der Non-Marxismus) hält mit John Milios „den Wert (und das Kapital) als soziale Relation“ für „die grundlegende Entdeckung bei Marx“, „insofern der Wert die Beziehung zwischen den Begriffen Geld und Ware ist (und nicht ausdrückt). Ware und Geld (als Form) können also nicht unabhängig vom Wert existieren…“ (141). Und weiter (148): „Die Geltung des Geldes qua Kaufkraft markiert… eine Abspaltung des Geldes gegenüber allen Waren, womit das Geld zugleich einer Entwicklung anheimgegeben ist, die auf Vermehrung in primärer Potenz abzielt, was wiederum das Geld innerhalb seiner Äquivalenzrelation mit den Waren gar nicht leisten kann.“ Zumindest der Gefahr einer solchen Entwicklung (der Potenzierung) ist das Geld ausgesetzt – aber diese Anheimgebung wird nicht (wie E.B. suggeriert) „durch den Tausch gegeben, sondern setzt das Kapitalverhältnis zwingend voraus“; nur hier, mit dem Kapitalverhältnis, kann sinnvoll vom Zwang die Rede sein, weil mit ihm „der Terror in die Welt kommt“ (E.B. 347).
Für die Reproduktion einer komplexen arbeitsteiligen Ökonomie „wird ein Numéraire benötigt (…) Keynes faßt das Geld als Numéraire bzw. Recheneinheit, die hier schon rudimentär für das Maß des Werts und des Kredits gilt, als die wichtigste aller Geldfunktionen.“ (Szepanski 148/149)
Weil E.B. diese Werteinheit für verzichtbar hält, hat er nirgends die Frage Wieviel? klären können.
„Wo das Geld dieser Welt jeweils nicht genug an Waren abpressen kann, um mit ihnen ein ausreichendes Mehr an Geld zu gewinnen, kann Geld solche Gewinne einerseits vorwegnehmen. Dafür bedient sich das Geld vorläufig nicht mehr der Waren, sondern seiner selbst: Es bedient sich bei sich selbst und generiert Geldgewinne aus Geld. So begründet und erzwingt es eine eigene Finanzwirtschaft.“ Auf den Zwang werden wir zurückkommen – aber es ist immerhin klar, daß „auch diese Gewinne in letzter Instanz an Waren gebunden“ sind: „Irgendwann müssen sich alle Gewinne durch Waren realisieren, indem sie jemand durch den Verkauf von Waren erzielt, und sie müssen sich in Waren realisieren“ (wir würden sagen: über Waren), „indem jemand mit ihnen Waren zu kaufen vermag.“ Es ist diese schludrige Redeweise, die ständig jede x-beliebige Ware (seien es Äpfel oder Derivate) mit der Ware Arbeitskraft identisch setzt, weshalb die Lektüre so ermüdend wird, weil man ständig herumrätselt, wovon jetzt eigentlich die Rede ist. Diese Schludrigkeit ist auch ärgerlich, weil es beim „Mehr“ nicht unbedeutende Unterschiede gibt: die kleine Preisvolatilität (mehr bezahlen, weniger bekommen oder umgekehrt), billiger einkaufen, aber teurer verkaufen (der Höker – und nichts anderes passiert an der Börse, wo es keinerlei Wertschöpfung gibt) und schließlich: die unbezahlte Mehrarbeit, das Mehrprodukt, der Mehrwert und (bei Realisierung desselben) das Mehrgeld (erst hier G´ ). Für E.B. mit seiner dualistisch Geldauffassung (ohne Geld – gut vs. mit Geld – böse) gibt es nur G plus (G+) – woher ein Plus (Gewinn, Profit, Zins) kommt, interessiert ihn nicht, weil er das Plus, das Mehrmotiv im Geld selbst gegründet sieht: „Es ist die beschriebene Logik der Selbstbezüglichkeit von Geld“, die seines Erachtens die „allgemeine Notwendigkeit, mit Geld zu Geldgewinn zu kommen“ begründet. Und „sobald es nur Geld gibt“, gibt es „Blasen“ – und dann auch bald, wenn sie (notwendigerweise) platzen, Krisen (weil die Welt der underlyings endlich ist im Gegensatz zum Geld). Aber gehört das, wie E.B. uns weismachen will, „zum Wesen des Geldes“ (340)? Könnte das Geld ohne Finanzwirtschaft tatsächlich nicht sein? „Die Erwirtschaftung von Geld mittels Ware reicht niemals aus und muß also ergänzt und erweitert werden durch Gewinne, die sich von den Waren lösen: Gewinne unmittelbar in der Abfolge Geld-Geld+.“ Unmittelbar! „Die Gewinne auf dem Warenmarkt benötigen ihre Fortsetzung durch Gewinne auf dem Geld- und Finanzmarkt. Deshalb (!) ist das Geld von diesem Markt abhängig, so wie er ist und wie er genau deshalb geworden ist. Er ist systemrelevant.“ (341) „Krise ist, wenn Geld nicht genügend Geld abwirft. Und darüber, ob es genügend Geld abwirft, entscheidet das Verhältnis einer gegebenen Menge Geld zu der spekulativ erwartbaren Menge an Gewinn.“ (343) So ist das im Kapitalismus – jedenfalls wenn man seine (Rahmen-)Bedingungen unkritisch voraussetzt und unhinterfragt akzeptiert. Wer fordert, „die Spekulation an die Kandare zu nehmen: durch Kontrolle der Banken, Einführung einer Transaktionssteuer, Verbot ´allzu´ spekulativer Papiere und Ähnliches“ (345), dem sagt E.B.: „Nichts könnte die Sache entschiedener verfehlen. Wie der gesamte Gang der Dinge in einer Geldwirtschaft ist auch der Gang aus der Krise auf eben die Spekulation angewiesen, die nach jenen Forderungen abgeschnürt werden soll. Die Spekulation einzuhegen und damit den Betreiber der Geldvermehrung einzuschränken, hieße exakt dasselbe noch verstärkt zu betreiben, wodurch die Krise heraufbeschworen wird.“ Das alles würde „die Krise nur weiter verschärfen. Innerhalb dieses Systems“ kommt (als „Rettung“) nur eines in Frage: „das Wachstum anzuheizen, also die Gewinnerwartungen wieder in die Höhe zu schrauben.“ „Die spezifische Selbstbezüglichkeit des Geldes, daß die Erwartung von einem Mehr an Geld real zu mehr Geld führt, legt diese Vermehrung insofern ganz in die Hand derer, die dafür nur mit der entsprechenden Gewinnerwartung agieren müssen.“ „Und so wird heute tatsächlich am Geldmarkt agiert, in diesem Punkt handeln die Einzelnen so weit wie nur möglich als Einheit mit allen anderen und in dem einen gemeinsamen Interesse: die Gewinnerwartung im rechten Maß spekulativ fortzusetzen. Und doch sind sie dabei gezwungen, auch gegeneinander zu handeln und darauf zu achten, in jedem Fall noch vor den anderen das Scheitern einer Spekulation zu erahnen und rechtzeitig ihr Geld abzuziehen, auch wenn sie so die allgemein gebotene Gewinnerwartung zurücknehmen – mit den absehbaren Folgen. Denn dazu zwingt sie, gegen das gemeinsame Interesse, ihre Konkurrenz.“ (345/346) So sieht man, wie sie Opfer des Privateigentums und der Konkurrenz sind. „So kommt der Terror in die Welt.“ (347) „Jede andere Form des Wirtschaftens, des Zusammenlebens und der Gemeinschaft“ wird „von den geldgetriebenen Mächten gezielt verboten und zerstört und ersetzt durch die einzige, die Geld-Gesellschaft.“ (348)
Was sich kapitalismuskritisch anhört, ist de facto bloß das TINA-Argument: die Geldvermehrung ist alternativlos – ein triebgesteuerter Wiederholungszwang. Aber um was für eine Art Trieb handelt es sich bei diesen „geldgetriebenen Mächten“? Geht es hier um den „Bereicherungstrieb“ (Marx MEW 23:168 und 618)?
Geld ist nicht „nichts“ (199f.), sondern ein Tauschwertversprechen: es ist eine Art Gutschein entweder für die noch ausstehende Gegenleistung einer bereits erbrachten Leistung oder die vorweggenommene Gegenleistung einer noch zu erbringenden Leistung. Man tauscht nicht unmittelbar Leistung und Gegenleistung, sondern trennt diesen Tausch und macht aus ihm zwei Akte: Leistung – Geld, Geld – Gegenleistung. Hier gibt es immer eine gewisse Volatilität, weil es keine wirkliche Äquivalenz geben kann (weder beim Gütertausch noch beim geldvermittelten Warenkauf), wenngleich man so tut, als ob es sie gäbe… Aus dieser Sicht sollte klar sein, daß Geld kein Ding oder „etwas“ (200) ist, das intrinsischen Wert hätte, sondern „nur“ ein gesellschaftliches Verhältnis auf der Basis von Vertrauen: Wer Geld akzeptiert, geht davon aus, daß er etwas dafür bekommt. Die Perversion beginnt, wenn man im Geld nicht mehr nur ein Mittel für Lebensmittel sieht, sondern es als Zweck an sich selbst betrachtet (als Selbstzweck) und anfängt, im Geld etwas zu sehen, das man vermehren kann (G – G´). Und wenn man glaubt, bloß weil der Gutschein einem gehört, ein Recht zu haben, ihn zur Geldvermehrung einzusetzen. Es ist nicht einzusehen, daß das zwingend so sein muß – daß es zwingend so zu sein scheint, ist ein der Erklärung bedürftiges Phänomen. Diese Erklärung ist E.B. mit seiner Behauptung der Selbstbezüglichkeit des Geldes nicht gelungen. Anstatt eben diese Selbstbezüglichkeit zu er/klären, sitzt er dem Geldfetisch auf. Der größte Teil der Menschheit „muß“ nicht nur deswegen für Geld arbeiten, weil es in großen arbeitsteiligen Gesellschaften (noch) keine Möglichkeit gibt, ohne Geld an Lebensmittel zu kommen, sondern vor allem deswegen, weil ihnen die Produktionsmittel nicht gehören, die im Privatbesitz sind; die Produktionsmittelbesitzer können andere für sich arbeiten lassen – was aber keine Erfindung der Neuzeit ist: die Herrschaftsverhältnisse in den von E.B. unkritisch verehrten Verpflichtungsgemeinschaften waren vertikal-hierarchisch strukturiert, um den Herrschenden mehr (Reichtum) zukommen zu lassen, als sie an Lebensmitteln benötigten. Das hat (an sich) gar nichts mit Geld zu tun. Das Geld war dann aber (wie E.B. aufgezeigt hat) ausgezeichnet dazu geeignet, die alten Herrschafts- und Machtstrukturen im Zuge der sich im langen 16. Jh. wandelnden Verhältnisse aufrecht zu erhalten; indem man die Menschen jetzt für Geld für sich arbeiten ließ, brauchte man sich außerdem auch nicht weiter um sie kümmern – man war die Pflicht zur Verantwortung los bzw. delegierte sie späteran den Staat. Die Rolle des Staates ist hier natürlich ein Thema für sich… Sicher könnte der Staat heute, wenn er denn wollte, auch anders. Aber solange wir heute nicht wissen, ob es morgen (wieder) ohne Geld gehen könnte (wenn ja, dann hoffentlich nicht wie im Feudalismus!), werden wir Alternativen in der Geldwirtschaft gegen die Macht des privaten Kapitals erkämpfenund ausprobieren müssen, wenn wir in den zahlreicher werdenden Krisen nicht untergehen wollen.
Wenn sich in der Neuzeit mit Pascal die Frage stellt: „Worauf wird der Mensch die zweckmäßige Ordnung der Welt, die er regieren will, gründen?“, dann gehört zur „gesetzlosen Setzung“ sicher nicht nur der Staat (Hobbes´ Leviathan), sondern auch das Geld – und „freilich“ ist die Wahrheit dieser gesetzlosen Setzung die „Herkunft aus Macht und Gewalt“ (A. Koschorke et al.: Der fiktive Staat, 152ff.). Die politische Theologie wird abgelöst von der politischen Ökonomie mit dem Staat und der Geldwirtschaft auf der materiellen Basis von Privateigentum, Kapital und Konkurrenz. „Die konfessionellen und politischen Bürgerkriege der Epoche hatten nicht nur Gemeinwesen verwüstet, sondern auch die soziale Ordnung als Schöpfungsordnung radikal in Frage gestellt.“ (151) „Kulturgeschichtlich gesehen vollzieht sich damit die Entdeckung des politischen Imaginären als solchem“ nahezu zeitlich (so ergänzen wir) mit der Entdeckung des ökonomischen Imaginären als solchem und ihrer „konstitutiven Rolle für die Einsetzung und den Erhalt sozialer Ordnung“ (153). So gesehen betreffen „die Strategien des Imaginären“ nicht nur die Ökonomie der Macht, sondern auch die Macht der Ökonomie: „Erst die Übertragung sämtlicher Machtansprüche der Einzelnen auf einen imaginären Dritten, eben den Leviathan“ mit (wir ergänzen) dem Mammon „als ´Ersatzgott´ und künstliches Subjekt der Allmacht, beendet den Machtkampf aller gegen alle und schafft so einen Zustand relativen Friedens“ (155). Wie auch immer:Das imaginäre Dritte von Geld und Ware ist der Wert.