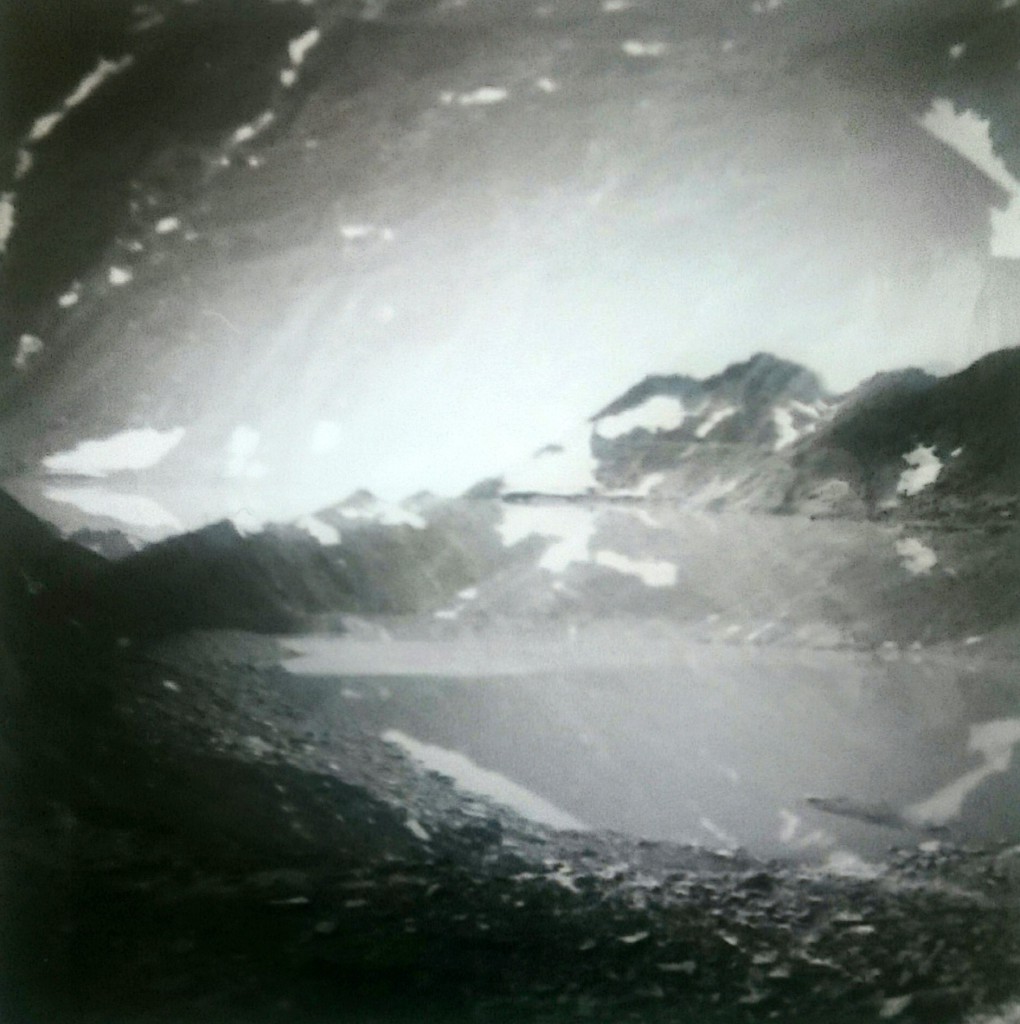In der Abwandlung eines Baudrillard-Zitats, das auf den unendlich wählenden Wähler gemünzt ist, könnte man schreiben: Die Kulturindustrie berieselt und enerviert zugleich das erregte und zugleich erschöpfte Nervensystem, lässt die Leute hören, bis sie selbst immer öfter hören wollen, und sie würden am liebsten noch viel mehr hören. Was nicht bedeutet, dass sie einen Geschmack hätten oder an die Bedeutung der Musik glauben würden – ganz im Gegenteil kommt darin das Verlangen nach einer Hör-Verfressenheit zum Ausdruck: Das Musiksystem wird in gefräßiger und exkrementeller Weise verschlungen und verdaut. Man entledigt sich seiner durch einen Exzess (nicht durch Ablehnung, sondern durch eine Verdauungsstörung) – das ganze System wird in einen riesigen weißen Musik-Wanst umgewandelt.
Dies heißt auch, dass der Retromodus in der Musik endgültig ubiquitär geworden ist. Zwar hat es im Pop, angelehnt an die Mode, von Anfang an Retrotendenzen gegeben, aber eine Zeit lang, laut Fisher bis in die 1990er Jahre hinein, sei es möglich gewesen, »Retro« von sog. zeitgenössischer Musik, die die Stimmungen einer Periode einfängt, abzugrenzen. Heute würden alle Retrostile als zeitgenössisch verkauft, gerade weil es keine wirklich zeitgenössischen Alternativen dazu gebe. Das sei wahrlich gespenstisch. Der Retromodus sei damit zum Standard geworden, i. e. Stile, Moden und Objekte, die Retro seien, würden als zeitgemäße Produkte verkauft, gerade weil die wirkliche Innovation im Jetzt nicht mehr stattfinde. Wenn alles Retro sei, sei es einerseits sinnlos, bestimmte Phänomene noch als Retro zu bezeichnen, andererseits sei auch nichts mehr Retro. Die Zeit würde weiß. (Ebd.: 2015)
Letztendlich findet damit aber auch immer die Insistenz auf das Zeitgenössische statt, womit die Gegenwart als ewig ausgedehnt erscheint oder sich dehnt wie niemals zerlaufender Käse. Das Zeitgenössische gerinnt zu einer Zeit, die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft okkupiert. Mit der Zeit ist es dann wie mit allen Transit-Orten – Einkaufszentren, Flughäfen, Museen und Sportarenen: Sie ist in all ihren Dimensionen (Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft) völlig austauschbar geworden, ganz egal, in welchem Jahr wir uns gerade befinden. Indem sie austauschbar ist, ist sie auch standardisiert. »Auf der Höhe der Zeit zu sein« war schon eine Beleidigung für Nietzsche, der zu Beginn seines Essays Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben stolz die Unzeitgemäßheit des Denkens proklamiert, »das heißt gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hoffentlich zu Gunsten einer kommenden Zeit – zu wirken.« (Unzeitgemäße Betrachtungen,1). Diese Beleidigung besteht weiter.
Mehr oder weniger resümiert Mark Fisher das, was Frederic Jameson schon lange vor ihm beschrieben hat. Jameson registriert in der postfordistischen Kultur eine Äquivalenz zwischen der beschleunigten Zirkulation der Differenzen auf allen Ebenen der sozialen Aktivitäten, des Designs der Gebrauchswerte, der Symbole, des Habitus etc., und gleichzeitig deren beispiellose Standardisierung und Funktionalisierung – Jameson schreibt: »Aber dann dämmert es uns, dass keine Gesellschaft jemals so standardisiert war, wie es diese ist, und dass der Strom von menschlicher, sozialer und historischer Zeitlichkeit noch niemals so homogen war.« (Jameson 1998: 57f.) Die homogene Zeit kriecht voran, und zwar nicht mittels der kruden »nackten Wiederholung«, die immer nur dasselbe wiederholt, sondern gerade mittels der von Deleuze oft erwähnten »bekleideten Wiederholung« von Differenzen, die im Zuge der Wiederholung der Variation die Bedingung ihrer eigenen Wiederholung interiorisiert; i. e. »bekleidete Wiederholung« ist die Interiorität des Werts als Differenz in sich selbst. Sie wird von einer seltsam stratifizierenden Kraft dominiert – eine scheinbar mit bunten Inhalten gefüllten Zeit, die jedoch der Kapitalisierung unterworfen bleibt. Es zirkuliert permanent der Schein radikaler Neuheit, während man in Wirklichkeit bewahrt.
Man müsste nun von so etwas wie einer Versität (Gleichmachung) sprechen, einer Inversion und Mutation der Diversität. Sie meint nicht die Eliminierung von Differenz bzw. der sozial-kulturellen Differenzierung, ganz im Gegenteil benutzt Versität die Differenz als ihr reales Substrat, um bestimmte standardisierte Organisationssysteme zu generieren. Ständig werden neue Ordnungssysteme und Machttechnologien generiert, welche die Differenzen absorbieren oder modulieren. (Die Aktivitäten der gegenseitigen Beeinflussungen der jeweiligen Netzknoten lassen sich mit Diffusions-Reaktionsgleichungen beschreiben und dies führt zur Erkennbarkeit von Muster- und Clusterbildungen, bspw. von Krankheitsherden und -verläufen. Es ist auch leicht nachzuvollziehen, dass sich mit Hilfe der Graphentheorie bestimmte Parameter wie Dichte, Relation und Relata von ökonomischen Größen im Kontext der monetären Transaktionen an den Finanzmärkten abbilden bzw. illustrieren lassen. Dabei schaffen die algorithmischen Infrastrukturen bestimmte Bedingungen für die Normalisierung und Standardisierung der jeweiligen Kommunikationen und Transaktionen. Biopolitische Verfahren der Kontrolle werden qua »Big Data« präventiv eingesetzt, so z. B. über die Auswertung der Daten bei Twitter und Google, um daraufhin epistemologische Netzwerke aufzubauen, die der staatlichen Biopolitik im globalen Kontext zur Früherkennung von Aufständen und Epidemien aller Art dienen können.)
Hier wäre natürlich sofort Adorno zur Stelle, wenn er zur Kulturindustrie schreibt: »Der Ausdruck Industrie ist dabei nicht wörtlich zu nehmen. Er bezieht sich auf die Standardisierung der Sache selbst – etwa die jedem Kinobesucher geläufige der Western – und auf die Rationalisierung der Verbreitungstechniken, nicht aber streng auf den Produktionsvorgang.« (Adorno 1963: 339) Die Rationalisierung der künstlerischen Verfahrenstechniken, man denke etwa an das wohltemperierte Klavier, geht für Adorno sukzessive mit der Verwandlung der Kunstwerke, von Objekten, die eine Aura umhüllt, in standardisierte Waren, einher. Eine bestimmte technische Behandlung des künstlerischen Materials führt laut Adorno zur seriellen Produktion von Standardwaren, die je nach Medium auf ein überschaubares Ensemble von Signalen zusammengeschrumpft sind. Adorno fasst zusammen: Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Die Aussage erinnert zwar an bloße Ökonomie, jedoch will Adorno dies nicht als krude Determinationskraft verstanden wissen, vielmehr ist für ihn die Kultur ein System, insofern sich die Ökonomie in der Kultur als ihrem Gegenteil realisiert. (Verbreitungstechniken sind für Eshun die Nervensysteme des 21. Jahrhunderts und er sieht sie im Gegensatz zu Adorno positiv – im Rave, im Club und bei der Party. Als Matrizen des futurhythmischen Diskontinuums sind sie heute jedoch eher den Modi der Finance adäquat.)
Solch eine Kritik an der standardisierten Kulturindustrie und ihren Waren muss sich immer mit dem Vorwurf auseinandersetzen, sich nur moralisch darüber zu entrüsten, dass das Kapital ein Produkt mit einem Preis versieht und es damit schon standardisiert hat, noch bevor der Gebrauchswert qua Design standardisiert wird. Der naive Einspruch gegen eine derartige Realität, die man zumeist als Warengesellschaft tituliert, wird so vorgetragen, als sollte es irgendwie gerade diese standardisierte Realität verbieten, aus dem Gebrauchswert eine Ware zu machen. Angeödet von derlei Realität und gerade deshalb so einverstanden, hat man als Kritiker vergessen, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, dem Zeitgemäßen vorzuwerfen, dass es zeitgemäß ist, keinen Geschmack zu besitzen, sondern dass man die Kraft zum Unzeitgemäßen herauszufordern hat, die nur eine Kraft des Denkens sein kann. Oder nehmen wir den Geschmack. Darauf rekurriert das Künstler-Subjekt gerne, es lässt, wie Adorno sagt, in seiner Idiosynkrasie vom Geschmack sich leiten. Aber auch der Geschmack wird längst durch die Remixing- und Samplingmaschinen des Kapitals gedreht, er wird überkapitalisiert, überästhetisiert, übermedikamentiert, mit Marken und Kunst überhäuft, er wird weiß (das hat rein gar nichts mit dem Faden des Tao zu tun) – oder wahlweise wird er im Zuge verklemmter Sparprogramme auf den Ein-Euro-Geschmack reduziert. Was, wenn das Kapital selbst noch das Remixing übernimmt und musikalische wie finanzielle Objekte in multiplen Dimensionen behandelt?
Der Konsument, soweit er dazu finanziell in der Lage ist, will heute nicht nur sein Bedürfnis befriedigt, sondern auch seinen Wunsch verführt wissen, und er will sein Selbstmodell durch den Konsum im Sinne der Produktion eines Mehr (an Konsum) verändert wissen. Der moderne Konsument ist der Produzent eines reflexiven Konsums, er konsumiert nicht nur den Konsum, als Dienstleistender konsumiert er auch die Arbeit, als Bürger ist er untoter Konsument. Der Wunsch wird dabei weniger befriedigt, als dass er permanent angestachelt wird, um sich an den Zerebralkonsum zu heften, der entweder das Konsumieren konsumiert oder sich an Waren heftet, die mit Visiotypen und Narrativen derart aufgeladen sind, dass sie ein Phantombild konstruieren. Produkte (selbst die der Musik) sind heute weniger Dinge als Phantombilder. Und so stellt sich für den Konsumenten die Frage, ob er mit Coca Cola oder Pepsi Cola den Geschmack der Freiheit trinkt oder wie er die Freiheit mit dem Konsum von Red Bull forciert.
Das Branding involviert die Produktion eines emotional-kognitiven Mehrgenusses, der mit der Etablierung der Markenware an Narrative wie Freiheit, Ordnung, Abenteuer oder Lifestyle gebunden ist und permanent gereizt wird. Dafür benötigt die Ware nach wie vor ein symbolisches Äquivalent, das Geld, um zu zirkulieren. Nur wenn das Geld bedeutungsoffen ist, kann es als leere Verweisungsstruktur fungieren, als ein sog. medialer Transporter, der die Waren und ihre Zeichen und Narrative unaufhörlich zirkulieren lässt. Baudrillard hat seine Theorie der Virtualität an die Zirkulation von Zeichen gebunden, die in der Zirkulation nur noch auf sich selbst verweisen und deren Bedeutung oder Wert ein reiner Simulationseffekt ist. Allerdings ist Baudrillards These, dass Bedeutung und Realität im Zeichen implodieren, nicht zuzustimmen, denn selbst noch die Bits als Zeichen müssen bedeuten, aber was sie bedeuten, ist eben gleichgültig.
Foto: Stefan Paulus